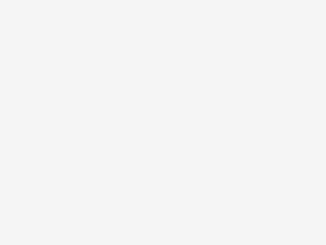PaD 22 /2020 – ausnahmsweise schon am Montag – und,
wie immer, auch als PDF verfügbar: PaD 22 2020 Rassenhysterie
Rassenhysterie
„Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln.“ (Bundesverfassungsgericht)
Inkriminierung vs. Diskriminierung
Die insbesondere in den USA und Deutschland zu beobachtende Tendenz, aus dem Grundsatz der Gleichheit vor dem
Gesetz unter allen – ungleichen – Umständen – die absolute Gleichheit aller menschlichen Individuen abzuleiten, entbehrt jeglicher Grundlage und zeugt von einer zutiefst menschenverachtenden Gesinnung.
Dies gilt es im Folgenden zu belegen. Zum Einstieg:
Ein surreales Gedankenexperiment
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer Wanderung. Die Sonne scheint, ein sanfter Wind weht, und weiße Schäfchenwolken zieren das Himmelsblau. Sie kommen gut voran und erfreuen sich an der Natur. Dann ziehen von Westen her dunkle Wolken auf, der Wind frischt böig auf und Sie meinen, aus der Ferne leises Donnergrollen zu vernehmen. Das Gewitter kommt rasch näher, erste schwere Tropfen fallen. Grelle Blitze zucken über den Himmel, ein ohrenbetäubendes Krachen ertönt.
Sie jedoch gehen vollkommen unbeeindruckt weiter Ihres Weges, denn Sie wissen, dass die Atmosphäre seit jeher nur „Wetter“ erzeugt, während es sich bei der Unterscheidung in Kategorien wie „Windstille“ und „Sturm“, „Sonnenschein“ oder „Blitzentladung“, lediglich um Konstrukte alter weißer Männer handelt. Ihrem Begleiter, der darauf dringt, vor den Blitzen Schutz zu suchen, halten Sie vor, die Gefährlichkeit von Blitzen sei lediglich ein Vorurteil, man dürfe nicht von jenem einen Blitz, der angeblich einmal ein Haus in Brand gesetzt haben soll, was übrigens längst nicht zweifelsfrei bewiesen ist, auf alle Blitze schließen. Es gelte, jedem Blitz offen und freundlich zu begegnen, statt pauschal allen Blitzen skeptisch gegenüber zu stehen und sie in die Schublade eines Vorurteils zu stecken, denn schließlich seien sie – wie Sonnenschein und Schneesturm – real gar nicht existent, sondern lediglich Wetter.
Vorsicht! Behaupten Sie nun nicht, das könne man doch nicht vergleichen, das sei doch etwas völlig anderes! Mit dieser Aussage diskriminieren Sie garantiert entweder das eine, oder das andere.
Unterscheiden ist Diskriminieren
Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, das ist der ursprüngliche Wortsinn, dem erst spät, nämlich im späten 20. Jahrhundert von Sprachpfuschern das Odium des Verbotenen aufgepfropft wurde.
Das ist sogar, Stand heute, noch im Begriffsdeutungschamäleon Wikipedia so
nachzulesen, deshalb hier ein Screenshot. Wer weiß, was Wikipedia morgen an dieser Stelle ausweisen wird:

Die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen nützlich und schädlich ist so substantiell für das Leben auf der Erde, dass selbst niederste Vertreter der Flora darüber verfügen. Cyanobakterien, bekannt als Blaualgen, unterscheiden zwischen hell und dunkel und nutzen dies, um sich auf das Licht, die Energiequelle, zuzubewegen. Ohne diese Fähigkeit gäbe es keine Blaualgen, allenfalls Vorstufen, die jedoch immer wieder zugrunde gehen müssten, bis eine Mutation das Erfolgsgeheimnis entdecken und für sich nutzen würde.
Eine Fähigkeit ist immer das Ergebnis eines Lernprozesses
und der dabei gemachten Erfahrungen.
Die Unterscheidung zwischen den genetisch festgelegten Fähigkeiten einer Spezies und den individuell erworbenen Fähigkeiten des einzelnen Exemplars dieser Spezies, also zwischen dem, was wir mit unzureichender Trennschärfe als „Instinkt“ und „Ratio“ bezeichnen, entscheidet in höher organisierten Gesellschaften wesentlich über den Rang der Individuen innerhalb der jeweils interagierenden Gruppen, jedenfalls so lange, wie die gruppentypischen, genetisch bedingten Fähigkeiten, die in entscheidenden Situationen weiterhin benötigt werden, dabei nicht von den individuellen Fähigkeiten „überschrieben“, also beeinträchtigt werden.
Ein Beispiel:
Hat ein Drogenspürhund einmal gelernt, auf ein bestimmtes Suchtmittel anzusprechen, kann ihm das nicht mehr abtrainiert werden. Das führte, wie man sich leicht vorstellen kann, bei der Legalisierung von Marihuana in Teilen der USA zu massiven Problemen.
Man kann dieses Beispiel so interpretieren, dass die natürliche Prioritätenreihe attraktiver Gerüche (läufige Hündin, frisches Fleisch, etc.) und der davon ausgelösten Reaktionen, durch den Geruch der Suchtmittel und das dafür antrainierte „Anzeigeverhalten“ überschrieben wurde. Es ist mir nicht bekannt, doch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass etliche Exemplare dieser Spürhunde eingeschläfert werden mussten.
An dieser Stelle ist es angebracht, erstmals auf die Titelzeile dieses Abschnittes einzugehen: Inkriminierung vs. Diskriminierung
Inkriminieren, das heißt soviel wie: beschuldigen, bzw. anklagen, oft auch bezogen auf die Aussagekraft eines Beweismittels, so kann z.B. ein Schriftwechsel als inkriminierend, also „belastend“, angesehen werden.
Dem Inkriminieren liegt also ein tatsächlicher, bzw. vermuteter, oder auch nur ein vermeintlicher Verbotstatbestand zugrunde.
- Tatsächlich, wenn die Tat bewiesen und der Täter geständig ist;
- vermutet, wenn Indizien darauf schließen lassen, dass ein Verbotstatbestand wahrscheinlich erfüllt wurde, und
- vermeintlich, wenn eine Tat sich im Rahmen der Legalität bewegt, aber – zumeist aus einer moralischen Perspektive – als verwerflich angesehen wird.
Wesentliche Anteile dessen, was derzeit als Diskriminierung inkriminiert wird, bewegen sich im Raum jener Unterscheidungen, die als moralisch verwerflich, folglich als nicht einer vorgegebenen Haltung entsprechend angesehen werden, ungeachtet der Zweckmäßigkeit und Korrektheit der getroffenen Unterscheidungen. Der Trend verläuft derzeit so, dass noch vor wenigen Jahren akzeptierte, differenzierende Betrachtungen, also getroffene Unterscheidungen, vom „Zeitgeist“ zu Gunsten von Gleichheitstheorien abgelehnt und mehr und mehr inkriminiert werden, bis sich eine politische Partei diese inkriminierende Betrachtungsweise zu eigen macht und öffentlich so lange darauf herumreitet, bis sich auch im Bundestag eine Mehrheit findet, die einen Gesetzentwurf zur Kriminalisierung des Unterscheidungsvermögens und der dabei verwendeten, differenzierenden Begriffe verabschiedet.
Wie kommt es nun, dass dieser Trend, der ja vom differenzierenden Erkennen und Bewerten wegführt und als Ausdruck einer fortschreitenden Dekadenz angesehen werden muss, sich ungebrochen auf immer weitere Bereiche des Lebens ausdehnen kann?
Vollzieht sich hier ein im weitesten Sinne „natürlicher“ Prozess, welcher der quantitativen Beschränktheit der Geisteskapazität der Menschen folgt, und – um Platz für das viele Neue zu machen, womit Wissenschaft und Technik unser Denkorgan überfordern – eine „Kompression“ dergestalt erfordert, dass „Baccara“, „Berolina“, „Caramella“ und tausende weiterer Rosensorten erst auf „Rose“ zusammenschrumpfen, um dann, mit allem was blüht, der Einfachheit halber einschließlich der Stinkmorchel, auf den Oberbegriff „Blumen“ subsumiert zu werden?
Oder wird mit der Gleichmacherei ein Zweck verfolgt, der mit jedem Schritt, der getan wird, zugleich die Fähigkeit diesen Zweck vom vorgeblichen Ziel zu unterscheiden, soweit reduziert, dass der einzelne Schritt nicht mehr erkannt werden kann? Mir fällt hierzu ein, dass früher in breitem Konsens nach Stil und Inhalt fein säuberlich unterschieden wurde, zwischen lächerlicher Dummheit, Klamauk, Kalauer, Witz, Ironie, Clownerie, Satire, Zynismus, Sarkasmus, Dreistigkeit, Frechheit, Boshaftigkeit, Hetze und Hass. Dies ist heute auf nur noch zwei Begrifflichkeiten zusammengeschrumpft, die sich unabhängig von Inhalt und Absicht so unterscheiden:
- Satire: Das worüber auch die Regierung lacht.
- Hate-Speech: Das, worüber die Regierung nicht lachen kann.
Beide Erklärungsansätze greifen jedoch zu kurz. Als Folge geistiger Beschränktheit, wie sie im ersten Ansatz unterstellt wird, wäre die moralische Diskreditierung des Unterscheidungsvermögens ein Phänomen, das lediglich innerhalb einer einigermaßen abgrenzbaren (bildungsfernen?) Bevölkerungsschicht auftreten dürfte.
Als Folge eines neofeudalistischen Dünkels alleine, ist der Trend ebenfalls nicht zu erklären, zumal der Kreis der Herrscherfamilien und ihres parasitierenden Hofstaates zu klein ist, um so weitreichenden Einfluss auf die gesamte Bevölkerung auszuüben, woraus zudem kein erkennbarer materieller Nutzen erwächst.
Verfolgen wir also eine dritte Spur:
Vom Glück, diskriminiert zu sein
Die Diskriminierungserfahrung ist in der Regel so etwas, wie das Erweckungserlebnis von Wanderpredigern. Lange Zeit ahnen Diskriminierte nichts von ihrer Diskriminierung. Sie sind mit ihrem Dasein ebenso zufrieden oder unzufrieden wie alle anderen auch, richten sich ein mit ihrem Einkommen, versuchen, mit den Nachbarn auszukommen, warten mit den gleichen Wehwehchen in den gleichen Wartezimmern, fliegen mit den gleichen Charterfliegern in die Ferien, und zahlen im Voraus für ihre Urnengrabstätten auf den gleichen Friedhöfen.
Nun kann niemand, der einigermaßen bei Verstand ist, behaupten, auf dieser Welt ginge es stets und in jeder Beziehung gerecht zu. Selbst größte Philosophen kommen über pauschal-abstrakte Definitionen von Gerechtigkeit nicht hinaus und scheitern, so sie sich denn auf dieses Wagnis einlassen, an der Komplexität der Parameter, an denen „Gerechtigkeit“ bemessen werden müsste.
Andererseits wird aber auch jeder verständige Beobachter erkennen, dass vergleichbare Gruppen unter vergleichbaren Bedingungen zumeist auch ziemlich gleichartig handeln und behandelt werden, was dem Gerechtigkeits-Ideal – zumindest wenn man sich auf Kant beruft – ziemlich nahe kommt.
Das Erweckungserlebnis der Diskriminierten erfolgt in aller Regel dann, wenn sie – freiwillig oder von Umständen gezwungen – aus ihrer persönlichen Vergleichsgruppe mit den vergleichbaren Bedingungen herausgehen und als Minderheit in einer anderen, irgendwie „überlegenen“ Gruppe in einer wenig vergleichbaren Umgebung ihre Andersartigkeit als Problem wahrnehmen.
Das wäre eigentlich der Augenblick, in dem die Fähigkeit, die wesentlichen Unterschiede zu erkennen, dazu verhelfen könnte, sich in allen relevanten Kriterien an die neue Umgebung anzupassen und so erneut als Teil einer vergleichbaren Gruppe unter vergleichbaren Bedingungen auch gleichartig zu handeln und behandelt zu werden.
Wo allerdings statt der wesentlichen Unterschiede nur die augenfälligen Unterschiede erkannt werden, ist der Weg zur Anpassung wegen dieser unzureichender Erkenntnisfähigkeit versperrt.
Weil jeder, der den letzten Satz verstanden hat, keine Beispiele braucht, fällt es leicht, darauf zu verzichten. Es waren zuerst wirklich nur die augenfälligen Unterschiede, die von Minderheiten als Begründung dafür herangezogen wurden, dass sie sich der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft nicht anzupassen vermochten, weil die wesentlichen Unterschiede weit hinter ihrem Horizont verborgen blieben.
Um hier einem Irrtum vorzubeugen: Es ist immer die Rede von gesellschaftlichen Gruppen, und zwar von Gruppen in vergleichbaren Verhältnissen, nicht von der Gesamtheit einer Bevölkerung. Daher können Frauen – zum Beispiel – auf jedem gesellschaftlichen Niveau für sich eigenständige Gruppen darstellen. Sehen einzelne davon ihre Berufung darin, in die parallel existierenden Männergruppen einzudringen, dann kann sich das für diese durchaus zu einem traumatisierenden Erlebnis entwickeln, soweit sie unfähig sind, über die augenfälligen körperlichen Unterschiede hinaus, nichts zu erkennen, was sie von den Männern, Männer von ihnen unterschiede. (Von jenen anderen, denen es gelingt, sich den Gepflogenheiten der Männerdomäne anzupassen, die es durchaus gibt, braucht hier nicht weiter gesprochen zu werden. Sie sollten sich daher von diesem Text nicht betroffen, und sich auch nicht berufen fühlen, als Anwalt ihrer weniger anpassungsfähigen Geschlechtsgenossinnen aufzutreten. )
Aus der Unfähigkeit, wesentliche Unterschiede zu erkennen, resultiert eine Reihe von Trugschlüssen, die in der finalen Erkenntnis gipfeln, Männer hätten sich verschworen, Frauen zu unterdrücken, also zu diskriminieren.
Dass Geschlechterrollen sich im Laufe der Evolution schon früh ausdifferenziert haben und bei allen heute existierenden, zweigeschlechtlichen Lebensformen grundsätzliche Unterschiede im Verhalten, aber auch im Körperbau, zu beobachten sind, die jeweils eine artspezifische Anpassung an die Umweltbedingungen darstellen, mit dem allen Arten gleichen Ziel, optimale Voraussetzungen für den Arterhalt zu schaffen, sollte Teil des nicht mehr in Zweifel zu ziehenden Allgemeinwissens sein. Dies zu verdrängen, und stattdessen aus dem hohlen Bauch heraus den Schluss zu ziehen, dass die – über einige hunderttausend Jahre Menschheitsgeschichte im Wesentlichen gleichgebliebenen – Rollenmuster von Männern und Frauen lediglich ein soziales Konstrukt und von daher zu überwinden seien, ist ein Irrtum, dessen Attraktivität einzig darin besteht, mit Diskriminierungsvorwürfen Schuldgefühle erzeugen, und aus diesen sowohl ideellen als auch materiellen Profit schlagen zu können.
Quotenfrauen in Aufsichtsräten, Konzern- und Parteivorständen und Quotenfrauen auf (Gender-) Lehrstühlen in den Universitäten sind dabei nur die Spitze des Eisbergs, von wo aus reichlich von der Gelegenheit Gebrauch gemacht wird, allen nicht so privilegierten Frauen einzureden, würden sie sich nicht unterdrücken und diskriminieren lassen, sondern auch für sich Quoten fordern, ließe sich die verbrecherische Männerherrschaft endgültig brechen.
Das Entsetzliche daran, was den Irrtum so unüberwindlich macht, ist die felsenfeste Überzeugung, Frauen seien nur deshalb „fraulich“, und nicht männlich, weil die Männerverschwörung sie über lange, lange Zeiträume so geformt habe. Es ist der Mangel an Erkenntnisfähigkeit, der inzwischen auch bei vielen Männern zu diagnostizieren ist, der verhindert, dass die einfachste Lösung des Mirakels „Mann und Frau“ da gesucht wird, wo sie liegt: Männer und Frauen haben, lange vor der Erfindung des aufrechten Ganges, gemeinsame Verabredungen über die Rollenverteilung getroffen, wobei das optimale Modell – im Sinne der Erhaltung der Art – zur dominanten Erscheinung der Rollenbilder geworden ist, während allfällige „Ausreißer“ mangels Fortpflanzungserfolg wieder untergegangen sind. Je weiter die so genannte „Emanzipation der Frau“ von ihrer Mutterrolle fortschreitet, und das kann so schwer zu begreifen nicht sein, desto schwieriger wird es, den für die Arterhaltung erforderlichen Fortpflanzungserfolg zu erzielen. Wenn zugleich eine Verweiblichung/Verweichlichung der Männer erreicht wird, worauf derzeit alles hindeutet, ist das „Aussterben“ jener gesellschaftlichen Gruppen, in denen dieser Prozess stattfindet, eine reale Gefahr. Wo die Lehre von der Ununterscheidbarkeit der Geschlechter mit Hilfe von Antidiskriminierungsgesetzen zur Staatsdoktrin erhoben wird, ist das der beste Weg zur Ausrottung der Intelligenz eines ganzen Volkes, da nur die Angehörigen der Unterschicht wegen ihres Mangels an Bildung und Intelligenz nicht dahin gebracht werden können, ihr natürliches Rollenverständnis zu hinterfragen und aufzugeben.
Sehr viel älter als der Feminismus,
der eine ganze Welle an Diskriminierungstatbeständen hervorgebracht hat, die bis dahin reichen, das angeblich ein „Kavalier der alten Schule“, der einer Frau zuvorkommend die Türe aufhält, schon als Chauvinist und Frauenverächter angepöbelt werden kann, weil er durch sein Verhalten zum Ausdruck bringe, die Frau sei unfähig, selbst die Tür zu öffnen,
ist die aus schlechten Erfahrungen gewonnene Erkenntnis, dass man Fremden, vor allem wenn es viele sind, zunächst einmal mit vorsichtiger Zurückhaltung begegnen sollte.
Diese schlechten Erfahrungen sind nicht aus jener Luft gegriffen, die von Rassisten ausgeatmet wird, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass Fremde, so sie nicht als Gäste, die auch wieder weiterziehen werden, willkommen sind, unweigerlich einen Teil der Ressourcen beanspruchen, die vorher der alleine in einem Gebiet lebenden Bevölkerung zur Verfügung standen.
Seien es Landflächen für Ackerbau und Viehzucht, Baumaterialien aller Art, aber auch heiratsfähige Frauen – überall muss der Fremde sich bedienen, will er sein Überleben in der Fremde sichern. Das kann nicht nur auf Nächstenliebe treffen. Je mehr Fremde sich irgendwo ansiedeln, wo es unter den Einheimischen schon eng zugeht, desto naheliegender ist der Gedanke: Ohne die Fremden ginge es uns besser.
Das soll – so genau weiß es niemand – schon bei den Höhlenmenschen der Steinzeit dazu geführt haben, dass man Fremde vorsorglich gewaltsam vom eigenen Revier fernhielt, umgekehrt dazu, dass die Fremden sich des Reviers gewaltsam bemächtigten. Alle Angriffskriege der Weltgeschichte hatten das Ziel, Beute zu machen. Alle Verteidigungsanstrengungen hatten das Ziel, das Eigene zu retten und den Angreifer dabei möglichst so vernichtend zu schlagen, dass er so schnell nicht wiederkommen würde.
Dass man heute erzählt, Soldaten zögen aus, um Mädchenschulen zu errichten und Brunnen zu bohren, um das gutmenschliche Herz anzurühren, und sie zögen aus, um den Völkern Erlösung und Demokratie zu bringen, um die Herzen der Leser von ZEIT und Süddeutscher Zeitung anzurühren, während im Handelsblatt schon einmal aufgelistet wird, über welche Bodenschätze der Schurkenstaat verfügt, entspricht allen früheren Erzählungen über Kriegsgründe. Statt der Demokratie wollte man früher den christlichen, wahlweise auch den muslimischen Glauben verbreiten, und statt Brunnen zu bohren und Mädchenschulen zu errichten war die Zerstörung heidnischer Heiligtümer ein wichtiges, gottwohlgefälliges Unterfangen, vor allem, wenn sie aus purem Gold bestanden und – in Stücke gehauen – leicht zu transportieren waren.
Auch dieses Verhalten, sowohl, was das Eindringen von Fremden in gewachsene Strukturen betrifft, als auch was das Verhalten zur Verteidigung des Eigenen betrifft, ist zu einem erheblichen Teil nicht erdacht oder in Erzählungen von Generation zu Generation weitergegeben, sondern bereits ganz massiv genetisch angelegt. Verhaltensforscher bestätigen, was Imker schon lange wissen, dass nämlich selbst Bienenvölker zwischen den Angehörigen des eigenen Volkes und fremden Bienen sehr fein unterscheiden. Manchmal gelingt es einer Honigbiene, die sich verflogen hat, in einem fremden Stock aufgenommen zu werden, wenn allerdings die Lage des Volkes prekär ist, wenn die Vorräte knapp werden, sorgen die Wächterbienen sehr robust dafür, dass sich keine Biene aus einem anderen Volk einschleichen kann – von Wespen und Hornissen ganz abgesehen.
Was bei Insekten funktioniert, sehen wir ebenso bei höheren Tierarten, die in Familienverbänden oder Rudeln gemeinsam ein Revier nutzen. Fremde Exemplare der gleichen Art werden vertrieben, im Zweifelsfall kommt es zum Kampf um das Revier – wobei der Unterlegene weichen muss.
Eine gewisse Distanz (eine Armlänge?) zu Fremden zu wahren, ist entwicklungsgeschichtliches Erbe der Menschheit.
Rassismus ist etwas anderes.
Rassismus ist eine Interpretation der Rassenlehre, der ihre wissenschaftliche Berechtigung allerdings vom „Zeitgeist“ abgesprochen wird.
Die „Rasse“ ist die Erscheinungsform eines für bestimmte Umweltverhältnisse gut angepassten „genetischen Pools“. Die Angehörigen der Rasse, ursprünglich immer an eine geografische Lage, zum Teil auch in eine im weitesten Sinne volksähnliche Gesellschaft gebunden, haben über lange Generationenfolgen diesen Genpool durch Auslese-Erfolge „konstruiert“. Dass der Begriff „Rasse“ heute aus ideologischen Gründen aus der wissenschaftlichen Literatur ebenso getilgt ist, wie der Negerkönig aus Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“, dass „Rasse“ heute als „Art“ oder „Unterart“ etikettiert wird, ändert allerdings nichts daran, dass der rassen-, bzw. unterartspezifische Genpool existiert und ungeachtet der Benennung fortwirkt. Die Ergebnisse lassen sich auf eine leicht verständliche Weise da demonstrieren, wo noch zwischen Pferd und Pferd, zwischen Rind und Rind, Huhn und Huhn unterschieden werden darf. Ein temperamentvolles Warmblut und ein massiger Kaltblütler, da ergeben sich nun einmal signifikante Unterschiede.
Dieser Aufsatz soll nicht zum Bilderbuch werden, daher wird auf die Darstellung weiterer Pferderassen, sowie von Rinder-, Hunde- und Geflügelrassen verzichtet. Selbergoogeln kann helfen, diesbezügliche Wissenslücken zu schließen.
Bleiben wir einzig bei den beiden im Bild vorgestellten Vertretern unterschiedlicher Pferderassen.
Es ist nicht auszuschließen dass es unter uns Zeitgenossen gibt, die dem schweren Kaltblüter einzureden versuchen, er würde diskriminiert, weil Exemplare seiner Art noch nie bei den Springreitern gesichtet wurden. Dass es sich dabei um kompletten Blödsinn handelt, weil der Kaltblüter sämtliche Hindernisse schlicht niederwalzen würde, ließe man ihn auf Pulvermanns Grab oder den doppelten Oxer los, ist offenkundig, hindert manche aber nicht daran, den Kaltblüter zu diesem, seinem vermeintlichen Glück zwingen zu wollen.
Dass die gleichen Gleichmacher allerdings sofort nach dem Tierschutz rufen würden, sollte der Hannoveraner Fuchs vom ersten Bild in einem Brauereigespann auftauchen, zeigt Zweierlei: Erstens, dass sie zweifellos doch zu unterscheiden wissen, und zweitens, dass sie die Wirkungen bestimmter Unterschiede aus ideologischen Gründen nicht akzeptieren können.
Weil Tiere ihren Rassencharakter und die damit verbundenen Fähigkeiten, nach allem was wir wissen können, schlicht annehmen, statt sich im Vergleich mit anderen Rassen diskriminiert zu fühlen, ist es nun an der Zeit, über die unterscheidbaren Rassen der Menschheit zu sprechen.
Es gilt von den Ausgangsbedingungen her das gleiche, wie bereits in Bezug auf das Tierreich angesprochen:
Die „Rasse“ ist die Erscheinungsform eines für bestimmte Umweltverhältnisse gut angepassten „genetischen Pools“. Die Angehörigen der Rasse, ursprünglich immer an eine geografische Lage, zum Teil auch in eine im weitesten Sinne volksähnliche Gesellschaft gebunden, haben über lange Generationenfolgen diesen Genpool durch Auslese-Erfolge „konstruiert“.
Allerdings tritt beim Menschen der Aspekt der volksähnlichen Gesellschaft deutlich stärker in den Vordergrund, weil Sitten und Gebräuche, die „Kultur“, durch Vorbild und Erziehung als außergenetischer Erfahrungsschatz die zusammengehörige Gesellschaft einheitlich prägen. Es ist daher wenig ergiebig, die grobe Unterscheidung in Afrikaner, Asiaten, Europäer, Indigene, usw. zu vertiefen. Viel interessanter ist es, gleich auf der Ebene der Völker, genauer gesagt, der Volksstämme weiter nach Unterscheidbarkeiten, also Diskriminierungsgelegenheiten zu suchen.
Dem deutschsprachigen Leser dieses Aufsatzes dürften die Europäer erfahrungsmäßig am nächsten liegen. Doch wird es schwierig, „den Europäer“ zutreffend charakterisierend zu beschreiben.
Gleich hinter der geografischen Eingrenzung der Herkunft aus Europa, hört es mit der Einheitlichkeit nämlich vollständig auf. Das gilt selbst dann, wenn man die auch unter den Europäern erkennbaren äußerlichen Unterschiede vollkommen ausblenden sollte. Doch der eher ruhige blonde schwedische Hüne und der quirlige, deutlich kleinere, meist schwarzhaarige Italiener existieren nun einmal und sind als typische Vertreter der jeweiligen Abstammungsgemeinschaft nicht wegzuleugnen.
Es gibt, außer dem Neuzeit-Esperanto „Englisch“, das unter den meisten Europäern eine zumindest rudimentäre Verständigung möglich macht, keine gemeinsame Sprache der Europäer. Man kann zwar grob zwischen den romanischen Sprachen, zu denen Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch gehören, und den germanischen Sprachen, wie Deutsch, Luxemburgisch, Niederländisch, Englisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch, unterscheiden, sollte aber auch die slawischen Sprachen, Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Bulgarisch und Mazedonisch eben sowenig vergessen, wie Finnisch, Estnisch und Ungarisch, die wiederum Formen der uralischen Sprachfamilie darstellen.
Sprachliche Unterschiede gehen jedoch weit über das hinaus, was Vokabelbücher als Übersetzungshilfen anbieten. Wortschatz, Grammatik und Syntax eröffnen oder beschränken auch unterschiedliche rationale Denk- und emotionale Gefühlsräume. Ein Engländer kann „Wanderlust“ und „Schadenfreude“ vielleicht empfinden, aber nicht ausdrücken, weil ihm die Worte dafür fehlen. Ebenso wenig kann er in „Zugzwang“ oder „Erklärungsnot“ geraten.
Der Deutsche hat keinen Ausdruck dafür, was das ist, wenn er bei der Suche nach der fehlenden Socke einen Zehn-Euro-Schein zwischen den Couchpolstern findet. Der Engländer nennt das kurz und bündig „a serendipity“.
Interessanter als die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten des Wortschatzes sind jedoch die Unterschiede in der Grammatik.
Hier zwei Auszüge aus der Wikipedia, die Flexionen der Verben, und damit deren Bedeutungs-Aufladung im Unterschied zwischen der italienischen und der deutschen Sprache, betreffend.
Das italienische Verb
drückt in finiten Formen
- drei Zeitstufen mit den entsprechenden vorzeitlichen Tempora,
- zwei Aspekte
- (zusätzlich eine Verlaufsform),
- drei Personen,
- die Numeri Singular und Plural sowie
- die Genera verbi Aktiv und Passiv aus und
- bildet die vier Modi Indikativ, Konjunktiv, Konditional und Imperativ.
Bei zusammengesetzten Formen wird unter bestimmten Bedingungen auch das Genus des Subjekts oder des direkten Objekts unterschieden.
Deutsche Verben
- können zum einen verschiedene Formen des Infinitivs annehmen,
- zum anderen in finiten Formen erscheinen,
- die Tempus, Modus sowie Kongruenz mit dem Subjekt markieren.
- Die finiten Wortformen des Verbs selbst beschränken sich dabei auf eine Serie von Formen des Präsens (Gegenwart) und
- eine Serie von Formen des Präteritums (Vergangenheit),
- bei jeder davon Indikativ und Konjunktiv.
Alle weiteren Zeitstufen des Deutschen beruhen nicht auf Wortformen, sondern auf Verbindungen mit Hilfsverben (die ihrerseits dieselben Wortformen zeigen wie die Vollverben). Anders als im Englischen gibt es im Deutschen keine Hinweise darauf, dass Hilfsverben einer anderen grammatischen Kategorie angehören als Vollverben.
Interessant dabei, dass die jeweiligen Grammatik-Informationen offenbar von verschiedene Wikipedia-Autoren verfasst wurden, die ihre Erklärungen mit unterschiedlichen analytischen Ansätzen vorlegen, so dass eine unmittelbare Vergleichbarkeit nicht hergestellt wird.
Doch gibt es, bezogen auf die Sprachräume, durchaus weitere, statistisch signifikante Unterschiede in den Verhaltensweisen der betrachteten Gruppierungen, die ungeachtet der Tatsache, dass sie von „Gleichmachern“ als Vorurteile verurteilt werden, den durch Erfahrung oder Erzählung geprägten Erwartungshaltungen entsprechen.
Da ist das Nord-Süd-Gefälle der Temperamente, das auffällig mit den mittleren Sommertemperaturen korreliert. Heißblütig und aufbrausend der Sizilianer, von sprichwörtlicher Gelassenheit der Brite, bedächtig der Schwede.
Da ist das konzentrische Gefälle der Spiritualität. Byzantinischer Mystizismus bei den Russen, geschäftstüchtiger Feiertagsrummel in der Mitte und die Machtentfaltung des Katholizismus am westlichen und südlichen Rand.
Gibt es eine Korrelation zwischen den vielfältigen Genüssen der französischen Küche und der leicht entfachbaren Streikbereitschaft der Gallier? Eine Korrelation zwischen Fish&Chips und ungebrochener Kriegsbereitschaft bei den Briten?
Ist der stierkampfstolze Spanier nur ein Märchen, sind die Wohnwagengespanne der Niederländer pure Einbildung, gibt es tatsächlich keinen Unterschied zwischen dem Place Pigalle im Quartier Montmartre und St. Pauli im Bezirk Hamburg Mitte?
Nur um kurz daran zu erinnern, worüber Sie hier lesen: Es geht um Diskriminierung – Diskriminierung sowohl im ursprünglichen Wortsinne, der Unterscheidung, als auch um Diskriminierung im zeitgeistigen Wortsinne, als Herabwürdigung.
Wir sind immer noch bei den Unterscheidungen, und auch hier lässt sich die Schraube noch ein paar Umdrehungen tiefer ins Gewinde drehen. Überspringen wir Deutschland und begeben uns direkt nach Bayern.
Denn in Bayern gibt es eine Besonderheit, die in diesem Zusammenhang Beachtung finden soll. Ursprünglich kennt die bayerische Tradition drei so genannte „Stämme“: Die Altbayern, die sich in Ober- und Niederbayern, sowie der Oberpfalz tummeln, die Franken in Ober-, Mittel- und Unterfranken, sowie die Schwaben, die den Regierungsbezirk Schwaben zwischen Augsburg und Kempten besiedeln. Die Besonderheit, die ich schon angedeutet habe, ist der vierte bayerische Stamm: Die Sudetendeutschen. Nach dem zweiten Weltkrieg aus der Heimat im Sudetenland vertrieben, erreichte der Großteil von ihnen zuerst in Bayern das Gebiet der (späteren) Bundesrepublik Deutschland. 1950 bestand gut ein Fünftel der bayerischen Bevölkerung aus geflüchteten Neubürgern. Noch lagen die Städte in Trümmern und konnten kaum die eigene Bevölkerung aufnehmen. Also schickte man die Flüchtlinge aufs Land.
Es entstand die Situation, die eingangs schon geschildert wurde: Massen von Fremden wurden von der einheimischen Bevölkerung keineswegs begrüßt, sondern mit großer Skepsis und Vorsicht betrachtet. „Spielt nicht mit den Flüchtlingskindern!“, war eine gar nicht seltene Ermahnung an die Sprösslinge der Franken, Schwaben und Altbayern. Obwohl die Flüchtlinge überwiegend in Lagern untergebracht wurden, also die besten Voraussetzungen für die Bildung von Parallelgesellschaften bestanden, und später aus den Lagern heraus ganze Flüchtlings-Städte entstanden, u.a. Geretsried, Traunreut und Waldkraiburg, fassten die „Neubürger“ in der neuen Heimat Fuß, pflegten ihre Traditionen, wie die Franken, die Schwaben und die Altbayern die ihren, wuchsen aber schnell in die Aufnahme-Gesellschaft hinein, weil es ihnen nicht schwerfiel, sich anzupassen.
Als die bayerische Staatsregierung 1962 offiziell beurkundete, die sudetendeutsche Volksgruppe als einen Stamm unter den Volksstämmen Bayerns anzusehen, gab dies der zu dieser Zeit durchaus noch nicht vollständig gelungenen Integration einen zusätzlichen Schub, der vor allem die Motivation der Sudetendeutschen belohnte und stärkte, andererseits aber auch der latent immer noch vorhandenen Fremdenfeindlichkeit den Zahn zog.
Rassismus ist etwas anderes.
Die differenzierte Betrachtung von Volksgruppen, die zwangsläufig, wenn nicht von ideologisch Verblendeten betrieben, zur Feststellung spezifischer Merkmale führt, anhand derer sich Unterschiede feststellen und Unterscheidungen treffen lassen, ist selbst dann noch kein Rassismus, wenn aus den Unterscheidungen heraus bestimmte, sinnvoll erscheinende Verhaltensmuster im Umgang mit den jeweiligen Gruppen gewählt werden. Dass diese Verhaltensmuster – solange der Fremde fremd ist – durchaus auf die eine oder andere Weise abweisend und distanziert ausfallen können, ist auch noch kein Rassismus. Dass sich, wenn der Fremde besser bekannt ist, immer noch drei Wege auftun, nämlich die Beibehaltung des abweisend-distanzierten Verhaltens, das Umschwenken auf eine freundlich-nachbarschaftliche Beziehung, oder aber die totale Abschottung gegenüber dem Fremden, weil dessen Verhalten dies angeraten sein lässt, ist immer noch kein Rassismus – auch keine Diskriminierung im zeitgeistlichen Sinne.
Rassismus ist da zu finden, wo die Merkmale der Fremden mit den Merkmalen der eigenen Gruppe verglichen und vorsätzlich ganz oder überwiegend als „minder wertig“ eingestuft werden – und – dies zum Anlass genommen wird, die Fremden aus dieser Einschätzung heraus als minderwertige Geschöpfe zu behandeln, sie mit Schikanen zu überziehen und ihnen psychische und körperliche Verletzungen zuzufügen, Mord eingeschlossen, um ihre Anwesenheit auf dem eigenen Territorium zu beenden, bzw. um sie in die „Unsichtbarkeit“ von Ghettos zu verbannen.
Rassismus geht häufig mit dem Erlass von Rassen-(Trennungs-)gesetzen einher, weil dies als die einfachste und wirksamste Form angesehen wird, das Aufeinandertreffen der Rassengegensätze zu vermeiden und den inneren Frieden zu bewahren.
Rassismus kann daher Staatsideologie sein und gefördert werden, Rassismus kann aber auch ein Minderheiten-Konzept sein, das mehr dem eigenen Selbstwertgefühl dient als den vorgeblich plakatierten Zielen, doch eines ist immer gleich:
Rassismus ist stets das Symptom einer irreparablen Inkompatibilität zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsformen, bzw. unterschiedlicher gesellschaftlicher Verhaltensmuster, Wertvorstellungen und Glaubensinhalte, welche von einer – oder von beiden Seiten – als unerträglich angesehen werden. Die Parallele zu heftigsten Nachbarschaftsstreitigkeiten wegen vermeintlicher Nichtigkeiten ist hier unübersehbar.
Rassismus lässt sich daher, solange die Unterschiede nicht auf das von den „Rassisten“ als noch erträglich angesehene Maß abgebaut werden, weder per Gesetz noch per Moralpredigt beseitigen, zumal die vorgetragenen Argumente nicht auf das Problem eingehen, sondern es stattdessen verharmlosen, verschleiern und wegdefinieren.
Rassismus wird – ganz im Gegenteil – durch Beschwichtigungsversuche noch verstärkt, weil dadurch die Ursachen als „indiskutabel“ aus der demokratischen Meinungsbildung herausgenommen werden und die Möglichkeiten, die gewünschte Veränderung (ggfs. auch im Kompromiss) herbeizuführen, letztlich bis auf eine, nämlich die schiere Gewaltanwendung reduziert werden.
Rassistische Diskriminierung
Rassistische Diskriminierung gibt es. Daran besteht kein Zweifel und daran soll auch kein Zweifel geschürt werden. Wo ein Schwarzer im Lokal wegen seiner Hautfarbe nicht bedient wird, handelt es sich um rassistische Diskriminierung. Wo ein Jude, erkennbar an der Kippa, auf der Straße angepöbelt oder tätlich angegriffen wird, handelt es sich um rassistische Diskriminierung. Wo dem schwarzen Bewerber in Johannesburg der Vorzug vor dem besser qualifizierten Weißen gegeben wird, handelt es sich um rassistische Diskriminierung. Der Beispiele gäbe es viele, sie müssen hier nicht weiter ausgewalzt werden, und ein Rechtsstaat tut gut daran, Mittel und Wege zu finden, die Betroffenen vor Diskriminierung zu schützen.
Es gibt jedoch noch eine ganz andere Form der rassistischen Diskriminierung, die derzeit in Deutschland Hochkonjunktur hat, nämlich die Verleumdung des politischen Gegners, seiner Anhänger und Sympathisanten, ja sogar aller Kritiker der Regierungspolitik als Rassisten.
Es ist das gleiche Grundproblem: Fremde bedrohen Besitzstände und werden aus einem natürlichen Reflex heraus abgelehnt und bekämpft, während die Regierung beschönigt, verharmlost und vertuscht – und nach Kräften daran arbeitet, den natürlichen Reflex als Rassismus zu diskreditieren.
Allerdings offenbart dieses Verhalten, dass an den Heiligtümern der Demokratie, nämlich in den Parlamenten selbst, die Spielregeln inzwischen nur noch für das eigene Rudel mit dem richtigen Stallgeruch gelten. Erinnern sie sich nur an die unverrückbare Ablehnung bisher jedes einzelnen Kandidaten der AfD, der sich um das Amt eines Bundestagsvizepräsidenten beworben hat. Ein Recht, das bis dahin jeder im Bundestag vertretenen Fraktion zustand, wurde durch die geschlossene rassistische Abwehrhaltung derer, die schon länger da sitzen, schlicht und einfach ausgehebelt.
Rassismus ist in Deutschland auf den Straßen, in den Medien, in den Parlamenten und der Regierung allgegenwärtig. Ein übermächtiges, parteiübergreifendes Lager mit links-grün-internationalistisch-globalistischer Gesinnung steht im Krieg gegen das Lager jener, die eine konservative, auf die Wahrung nationaler Interessen abzielende Politik fordern.
Der moderne KuKluxKlan, schwarz, statt weiß vermummt, macht immer unbekümmerter Jagd auf alles, was von den Einpeitschern als „braun“, bzw. „alter weißer Mann“ diskriminiert wird, während die Systempolitiker ihre Sympathie für die Antifa immer offener zum Ausdruck bringen.
„Rechts“ steht in Deutschland inzwischen als Synonym für den „Nigger“ zu Apartheidzeiten in den USA und Südafrika.
Gaststätten, Hotels und Veranstaltungsräume hängen immer öfter das Schild ins Fenster: „Kein Zutritt für Rechte!“ Nicht aus Überzeugung, sondern aus begründeter Angst um Fensterscheiben, Mobiliar, Fahrzeuge und den Dachstuhl.
Auch Unternehmer anderer Branchen, die ihre eher konservative Haltung nicht konsequent genug verbergen, werden gerne von Boykottaufrufen getroffen.
Indymedia.org, die „eigentlich verbotene“ Hass- und Hetzseite der Linksrassisten ist unbehelligt von Polizei und Verfassungsschutz weiterhin online, verbreitet kaum misszuverstehende Aufrufe zu Attentaten, incl. detaillierter Hinweise über das zweckmäßigerweise einzusetzende „Werkzeug“, wie auch über sichere Anreise- und Fluchtrouten, und jubelt – mit „Bekennerschreiben“ – über jeden gelungenen Auftritt. Ob da Autos abgefackelt oder „Hausbesuche“ bei Kritikern stattgefunden haben, die Verantwortlichen Politiker und die Medien schweigen dazu eisern, bzw. erklären, es gäbe keine Erkenntnisse über die mutmaßlichen Täter.
So wie Satire nur noch das ist, worüber auch die Regierung lachen kann, ist die Strafverfolgung per Polizei und Staatsanwalt auch nur noch da erkennbar tätig, wo die Regierung entweder kein spezielles eigenes Interesse daran hat, oder sich darüber freuen kann. Politisch motivierte Straftaten von links gehören offenbar jedenfalls nicht zu den Schwerpunktthemen der Verantwortlichen für die Innere Sicherheit.
Doppelmoral
Die gleichen Geister, die, wenn es ihnen in der Kram passt, nicht aufhören, auf allen Kanälen von „der Menschheit“ zu faseln, und davon, dass kein Mensch illegal sei, und jeder Mensch das Recht haben müsse, sich überall auf der Erde niederzulassen und sich – so der Verfassungsgerichtspräsident Harbarth, als er noch Bundestagsabgeordneter war – von den dort schon länger Lebenden alimentieren zu lassen, stecken Abermilliarden in Rüstung und die Ausbildung und den Unterhalt von Kämpfern, deren einzige Aufgabe es laut Grundgesetz ist, „das Eigene vor dem Zugriff Fremder“ zu verteidigen. Sie heulen auf, wenn Donald Trump verkündet, er wolle US-Truppen aus Deutschland abziehen, weil damit der potentielle Feind, nämlich Russland, gestärkt werde.
Eine Stufe tiefer in der Hierarchie der Verteidigung des Eigenen stehen die Polizeien. Die Polizei ist Teil des Gewaltmonopols des Staates und dazu da, mit angemessenen Mitteln Straftaten durch Präsenz zu vermeiden und jene Straftaten, die nicht zu vermeiden waren, aufzuklären, die Täter dingfest zu machen und vor Gericht zu bringen. Gewaltanwendung ist dabei mit festgelegten Einschränkungen, je nach Sachlage gestattet und reicht vom einfachen – bei Gegenwehr schmerzhaften – „Haltegriff“, über den Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und Wasserwerfern, bis zum „finalen Rettungsschuss“.
Irgendwo dazwischen finden sich die Geheimdienste, deren Aufgabe es ist, Erkenntnisse über „die Fremden“ und die „Regierungsfeinde“ zu gewinnen und deren Pläne ggfs. mit geheimdienstlichen Mitteln zu unterlaufen.
In letzter Zeit mehren sich jedoch die Indizien für ein wachsendes Misstrauen der Regierenden gegen Bundeswehr, Polizei und den Diensten. Überall werden „Säuberungen“ gefordert und „Beauftragte“ installiert, um erkennen zu können, wo in den Abwehrkräften der Demokratie möglicherweise „Kreise“ existieren, die sich erinnern, dass sie ihren Eid nicht auf Merkel, Esken und Borchardt geleistet haben, bzw. dass ihre Dienstpflichten über das hinausreichen, was derzeit alleine Wohlgefallen bei der Staatsführung auszulösen vermag.
Es ist nur allzu naheliegend, auch hier, wie überall in der Gesellschaft, die Messlatte konservativ-nationaler Gesinnung anzulegen und daraus im Nu den Vorwurf des Rassismus zu konstruieren. Die Formel: „Wer die Interessen des deutschen Volkes vertritt, offenbart damit zugleich seinen Rassismus“, funktioniert ausgezeichnet. Gutmenschen werden mit Beispielen gefüttert, die gläubig angenommen werden, so dass sie zu Zehntausenden den Aufwieglern nachlaufen und jubeln, wenn in Berlin ein Gesetz erlassen wird, dass jedem, der das Wort „Diskriminierung“ aufsagen kann, das Recht zugesteht, vom Polizisten den Beweis zu fordern, er habe eine Personenfeststellung nicht wegen der Hautfarbe, eine Hausdurchsuchung nicht wegen der Religionszugehörigkeit, eine Festnahme nicht wegen rassistischer Vorurteile vorgenommen.
Ein Verfassungsschutzpräsident, der einem aus der Luft gegriffenen, nur der Propaganda und Hetze dienenden Rassismusvorwurf gegenüber der Bevölkerung einer ganzen Stadt mit seinem Wissen öffentlich widerspricht, wird in die Wüste geschickt. Razzien in Kasernen sollen Artefakte rassistischen Gedankengutes aufspüren und disziplinarische Maßnahmen, bis zur unehrenhaften Entlassung aus dem Dienst ermöglichen.
Man muss nicht unbedingt an Stalin denken, wenn man von Säuberung spricht, es genügt die alte bundesrepublikanische Praxis der Kommunistenhatz per Radikalenerlass mit Berufsverboten, nicht nur für Lehrer und Lokomotivführer zu erinnern. Von 1972 bis 1991 wurde bundesweit die Gesinnung von insgesamt 3,5 Millionen Personen geprüft. 1.250 überwiegend als linksextrem bewertete Lehrer und Hochschullehrer wurden nicht eingestellt, bei Post und Bahn traf der Radikalenerlass ebenfalls viele Bewerber und Beschäftigte, denen das Beamtenverhältnis versagt wurde, was einem Berufsverbot in vielen Fällen gleichgesetzt werden konnte.
Schon damals folgte die politische Ausrichtung in Westdeutschland mit geringer Verzögerung den Verhältnissen in den USA, wo Senator McCarthy als verbissener Kommunistenjäger zwar nur wenige Jahre aktiv war, aber eine tiefe Schneise der Verwüstung und Spaltung in der Gesellschaft hinterließ, die bis heute nicht vollständig geheilt wurde.
Es genügt bekanntlich, dem US-Präsidenten eine gewisse Nähe zu Russland zu unterstellen, um damit den Versuch zu unternehmen, ihn aus dem Amt zu vertreiben. Schließlich hat es nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, gegen Russland aufzurüsten, bis der Gipfel der Staatsverschuldung in den Wolken verschwindet; aber der Versuch, sich einer Flut real existierender fremder Eindringlinge mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu erwehren, das ist als das Ausleben niederster rassistischer Instinkte anzusehen.
Was liegt also näher, als dem Präsidenten und den nachgeordneten regionalen Administrationen mit dem gleichen Rassismusvorwurf gleich die gesamte Polizei aus den Händen zu nehmen. Halboffizielle, ernst zu nehmende Stimmen fordern die Auflösung der Polizei in Minneapolis, die danach „ganz anders“ wieder aufgebaut werden soll. In New York soll der Etat der Polizei beschnitten werden, dafür mehr Mittel für Streetworker und Sozialarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Anzunehmen, damit würden die Berliner Maßnahmen zur Einhegung der Polizei übertroffen, ist ein Irrtum. Berlin kommt ohne Amtshilfe der Polizeien aus den übrigen Bundesländern mit Kriminalität und Straßenterror nicht zurecht – und noch wollen sich die Innenminister anderer Bundesländer weigern, Polizisten nach Berlin zu entsenden. Die aus Sparsamkeitserwägung ausgedünnte Polizei wird dadurch in ganz Deutschland von einer Kündigungswelle heimgesucht werden, weil viele Polizisten nicht länger ihren Kopf für die Folgen einer Politik hinhalten wollen, deren Absichten und Ziele ihnen fremd sind.
Damit aber ist das Ziel erreicht. Die Demokratie entwaffnet, die freiheitlich demokratische Grundordnung dem Mob auf der Straße ausgeliefert, der sich noch, wie es scheint, von den Untergrundorganisationen der NGOs im Sinne jener Strategie lenken lässt, die Graf Richard Nikolaus Coudenhove Kalergi, ein Rassentheoretiker höchsten Grades, als geistiger Gründungsvater der EU ersonnen hat.
Nach seiner Vorstellung soll in Europa im Endzustand eine hauchdünne, feudale Oberschicht über willige, weitgehend entrechtete Arbeitssklaven einer hellbraunen Mischrasse minderer Intelligenz verfügen. Dazu muss Zuwanderung aus Afrika organisiert und die Rassenvermischung gefördert werden.
EU-Gründungsmythos: Rassismus
Zitate aus Kalerghis Hauptwerk „Praktischer Idealismus“
(Hervorhebungen von mir)
(S. 45) Von der europäischen Quantitätsmenschheit, die nur an die Zahl, die Masse glaubt, heben sich zwei Qualitätsrassen ab: Blutadel und Judentum. Voneinander geschieden, halten sie beide fest am Glauben an ihre höhere Mission, an ihr besseres Blut, an menschliche Rangunterschiede. In diesen beiden heterogenen Vorzugsrassen liegt der Kern des europäischen Zukunftsadels: im feudalen Blutadel, soweit er sich nicht vom Hofe, im jüdischen Hirnadel, soweit er sich nicht vom Kapital korrumpieren ließ. Als Bürgschaft einer besseren Zukunft bleibt ein kleiner Rest sittlich hochstehenden Rustikaladels und eine kleine Kampfgruppe revolutionärer Intelligenz. Hier wächst die Gemeinschaft zwischen Lenin, dem Mann aus ländlichem Kleinadel, und Trotzki, dem jüdischen Literaten, zum Symbol: hier versöhnen sich die Gegensätze von Charakter und Geist, von Junker und Literat, von rustikalem und urbanem, heidnischem und christlichem Menschen zur schöpferischen Synthese revolutionärer Aristokratie.
(S. 56) Aus diesem Zufallsadel von heute wird die neue internationale und intersoziale Adelsrasse von morgen hervorgehen. Alles Hervorragende an Schönheit, Kraft, Energie und Geist wird sich erkennen und zusammenschließen nach den geheimen Gesetzen erotischer Attraktion. Sind erst einmal die künstlichen Schranken gefallen, die Feudalismus und Kapitalismus zwischen den Menschen errichtet haben – dann werden automatisch den bedeutendsten Männern die schönsten Frauen zufallen, den hervorragendsten Frauen die vollendesten Männer.
(S. 22) Es gibt kein Leben der Tat ohne Unrecht, Irrtum, Schuld: wer sich scheut, dieses Odium zu tragen, der bleibe im Reiche des Gedankens, der Beschaulichkeit, der Passivität. – Wahrhafte Menschen sind immer schweigsam: denn jede Behauptung ist, in gewissem Sinne, Lüge; herzensreine Menschen sind immer inaktiv: denn jede Tat ist, in gewissem Sinne, Unrecht. Tapferer aber ist es, zu reden, auf die Gefahr hin, zu lügen; zu handeln, auf die Gefahr hin, Unrecht zu tun. Inzucht stärkt den Charakter, schwächt den Geist – Kreuzung schwächt den Charakter, stärkt den Geist. Wo Inzucht und Kreuzung unter glücklichen Auspizien zusammentreffen, zeugen sie den höchsten Menschentypus der stärksten Charakter mit schärfstem Geist verbindet. Wo unter unglücklichen Auspizien Inzucht und Mischung sich begegnen, schaffen sie Degenerationstypen mit schwachem Charakter, stumpfem Geist. Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.
(S. 23) Vorläufer des planetaren Menschen der Zukunft ist im modernen Europa der Russe als slawisch-tatarisch-finnischer Mischling; weil er, unter allen europäischen Völkern, am wenigsten Rasse hat, ist er der typische Mehrseelenmenschen mit der weiten, reichen, allumfassenden Seele. Sein stärkster Antipode ist der insulare Brite, der hochgezüchtete Einseelenmensch, dessen Kraft im Charakter, im Willen, im Einseitigen, Typischen liegt. Ihm verdankt das moderne Europa den geschlossensten, vollendetsten Typus: den Gentleman.
(S. 32) Demokratie beruht auf der optimistischen Voraussetzung, ein geistiger Adel könne durch die Volksmehrheit erkannt und gewählt werden. Nun stehen wir an der Schwelle der dritten Epoche der Neuzeit: des Sozialismus. Auch er stützt sich auf der urbane Klasse der Industriearbeiter, geführt von der Aristokratie revolutionärer Schriftsteller. Der Einfluß des Blutadels sinkt, der Einfluß des Geistesadels wächst. Diese Entwicklung. und damit das Chaos moderner Politik, wird erst dann ein Ende finden, bis eine geistige Aristokratie die Machtmittel der Gesellschaft: Pulver, Gold, Druckerschwärze an sich reißt und zum Segen der Allgemeinheit verwendet. Eine entscheidende Etappe zu diesem Ziel bildet der russische Bolschewismus, wo eine kleine Schar kommunistischer Geistesaristokraten das Land regiert und bewußt mit dem plutokratischen Demokratismus bricht, der heute die übrige Welt beherrscht.
Nun könnte man, wie ich es lange getan habe, das rassistische Gesudel des Grafen Kalergi, Sohn einer Japanerin und eines Österreichers, als Dokument eines überwundenen Zeitgeistes abtun, weil es – 95 Jahre nach dem Erscheinen dieses Buches, dessen Inhalt, von einem andern Autor vorgelegt, heute nie und nimmer noch einen Verleger fände – keinerlei Relevanz für die politischen Strebungen unserer Tage mehr habe.
Das Entsetzen folgt allerdings auf dem Fuße, wenn man erkennt, in welchem Maße Graf Kalergi gerade von unserem, sich jedoch bisher nur als Elite, noch nicht als „Führungsadel“ bezeichnenden, politischem Personal verehrt wird. Halten Sie die Luft an!
Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi wird allgemein als einer der bedeutendsten Vordenker der heutigen Europäischen Union angesehen. Schon 1924 gründete er die Paneuropa-Union, 1947 die Europäische Parlamentarier-Union (EPU), die sich 1952 mit der Europäischen Bewegung vereinigte. Der internationale Karlspreis der Stadt Aachen, wurde 1950 erstmals vergeben – „in Würdigung der Lebensarbeit Kalergis für ein geeintes Europa“.
Weitere Auszeichnungen und Würdigungen führt Wikepedia auf:
- 1950: Internationaler Karlspreis zu Aachen
- 1955: Großes Bundesverdienstkreuz
- 1962: Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich[23]
- 1965: Sonning-Preis
- 1966: Europäischer Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft
- 1967: Japanischer Erste Verdienstklasse Orden des Heiligen Schatzes und Japanischer Friedenspreis (Kajima heiwa preis)
- 1972: Konrad-Adenauer-Preis der Deutschland-Stiftung für Politik
- 1972: Europapreis des Syndicat des journalistes écrivains
- 1972: Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern
- Ehrenbürger der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Ritter der Ehrenlegion
- 2017: Europa-Coudenhove-Kalergi-Brunnen am Kirchplatz in Schruns[24]
Seit dem Jahr 2002 verleiht die Europa-Union in Münster die Coudenhove-Kalergi-Plakette, um damit Persönlichkeiten und Institutionen zu würdigen, die sich durch ihr Engagement für Europa ausgezeichnet haben. Die aus der Paneuropa-Union hervorgegangene Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi verleiht alle zwei Jahre den Coudenhove-Kalergi Europapreis an Persönlichkeiten, die sich in außerordentlicher Weise um die Einigung Europas verdient gemacht haben.
Wer die Kalergi-Zitate soeben gelesen hat, wird auch an diesem Zitat mit leicht erkennbarem Kalergi-Bezug aus dem Juni 2016 seine Freude haben:
„Die Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe. Für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer Offenheit und unserer Vielfalt. Schauen Sie sich doch mal die dritte Generation der Türken an, gerade auch die Frauen! Das ist doch ein enormes innovatorisches Potenzial!“
Nein, dieser Satz stammt nicht von Claudia Roth, wie man versucht sein könnte, zu meinen, es ist ein Satz von Wolfgang Schäuble, zur Verteidigung der von Angela Merkel eingeleiteten, unkontrollierten Zuwanderung nach Europa.
Angela Merkel selbst wurde übrigens lange vor der humanitären Grenzöffnung zur Erschließung weiterer innovativer Potentiale von der „Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi“ mit dem Europapreis 2010 für außerordentliche Verdienste im europäischen Einigungsprozess ausgezeichnet. Den Karlspreis hat sie selbstverständlich, wie auch Wolfgang Schäuble, ebenfalls erhalten.
Selbstverständlich gibt es keinen Kalergi-Plan.
Wer das behauptet, muss sich gefallen lassen, als Verschwörungstheoretiker aus dem Diskurs ausgeschlossen zu werden. Kalergi hat ja auch keinen Plan vorgelegt. Ich bitte Sie!
Kalergi hatte eine Vision. Eine Vision – keinen Plan.
Diese Vision beschränkte sich zudem auf Europa, wo – so die Vision – eine charakterschwache, willenlose (man kann das Zuchtziel im Kontext der Ausführungen kaum anders sehen) eurasisch-negroide Mischrasse in individueller Vielfalt ohne Bindungen an überkommene Abstammungsgemeinschaften leben und arbeiten sollte, die von einer Qualitätsrasse aus Blutadel und Judentum, nach dem Vorbild des segensreichen Wirkens von Lenin und Trotzki, in kommunistischer Form beherrscht werden sollte.
Ein Plan, dies absichtlich und gezielt herzustellen, wäre tatsächlich die Grundlage eine Verschwörung, zumal ein Einzelner, ohne Helfer und Helfershelfer, niemals in der Lage wäre, einen solchen Plan voranzutreiben. Wo eine Vision aber so wirkkräftig ist, dass sie von selbst auf die Träger der edelsten Rassemerkmale überspringt und sich wie von selbst durch deren Wirken verwirklicht, da handelt es sich stets um einen ganz normalen, schicksalhaften, menschheitsgeschichtlicher Prozess.
Kolumbus zu unterstellen, er hätte seine Expedition zur Entdeckung des Seewegs nach Indien nur gestartet, weil er insgeheim einen Plan zur Ausrottung der Indianer geschmiedet hatte, wäre eine ebensolche hirnverbrannte Verschwörungstheorie. Es hat sich alles so ergeben.
Rassenhysterie
Abschließend soll ein Blick auf die brandaktuellen Geschehnisse geworfen werden, die sich von Minneapolis aus wie ein Strohfeuer in rasender Geschwindigkeit bis nach Europa ausgebreitet haben.
Ein Weißer hat den Tod eines Schwarzen verursacht. Dass der Weiße Polizist war, wird ihm zum Nachteil ausgelegt. Dass der Schwarze ein drogenabhängiger Gewohnheitsstraftäter war, darf in die Würdigung des Vorganges nicht einbezogen werden. Das wäre zu viel, und nur verwirrende Unterscheidung.
Auch dass die – zugegeben ziemlich rabiate – Methode, den Widerstand eines Festgenommenen mit dem Knie im Genick zu brechen, durchaus den gültigen Vorschriften der Polizei von Minneapolis entsprach, also grundsätzlich nicht zu beanstanden war, darf keine Rolle spielen, denn das würde das einfache Bild: „Weißer Rassist bringt Schwarzen auf offener Straße um“, nur stören.
Die Geschichte weist zudem einige Merkwürdigkeiten auf, die sich nur schwer analysieren lassen, wohl aber ausreichen, um zum Zwecke weiterer Recherchen eine Hypothese aufzustellen. Letzteres überlasse ich jedoch dem geneigten Leser.
- Auslöser der Begegnung zwischen dem Opfer und dem Täter war ein Anruf aus einem Ladengeschäft, das spätere Opfer habe mit gefälschten Essensgutscheinen, später hieß es: mit Falschgeld, bezahlen wollen.
- Diese Beschuldigung wurde später zurückgezogen, der Schwarze habe mit offiziellen Dollarnoten bezahlt.
- Opfer und Täter waren sich persönlich bekannt, da beide im gleichen Nachtclub einer (Neben-)Beschäftigung nachgingen. Der eine als Türsteher draußen, der andere als Rausschmeißer drinnen. Es konnte also jeder von beiden das Verhalten des anderen einigermaßen abschätzen und sich darauf einstellen.
- Mehrere Quellen – die Lage ist hier aber sehr dünn – berichten, dass das Opfer bereits in den Streifenwagen gebracht worden war, dann aber, wegen einer durch Drogenkonsum noch verstärkten Klaustrophobie das Fahrzeug wieder verließ – ein Fluchtversuch? – was den Täter letztlich erst veranlasste, die Nummer mit dem Knie im Genick zur Ausführung zu bringen.
- Obwohl insgesamt vier Polizisten am Ort des Geschehens waren, wurde weder der Täter an der Tat gehindert, noch wurden die Video-Aufzeichnung, die eine Passantin vom Geschehen anfertigte, unterbunden.
- Es gibt inzwischen zwei Videos.
- Das erste Video zeigt den am Boden liegenden Schwarzen mit dem in seinem Genick knieenden Weißen. Darauf ist mehrfach (16 mal) zu hören, dass das Opfer sagt: I cant breathe – Ich bekomme keine Luft. Das ist zwar ein Widerspruch in sich, wer wirklich keine Luft bekommt, hat auch keine mehr zum Sprechen übrig, soll aber hier noch nicht interpretiert werden.
- Das zweite Video ist das Video einer Überwachungskamera. Es wurde öffentlich, nachdem die beteiligten Polizisten angegeben hatten, der Festgenommene habe sich der Festnahme widersetzt. Es zeigt exakt die Szene der (ersten) Festnahme, und tatsächlich hat sich das Opfer widerstandslos festnehmen lassen und folgte den Anweisungen der Polizisten.
- Von einem dritten Video, das die zwischen beiden Aufzeichnungen bestehende Lücke füllen könnte, das also zeigten würde, wie der Festgenommenen den Streifenwagen verlässt, und was bis zur Knieszene weiter geschah, ist, soweit ich weiß, bisher nichts bekannt.
- Letzte Merkwürdigkeit:
Die rasante Verbreitung des ersten Videos über alle verfügbaren Kanäle, die unmittelbare Reaktion aufgebrachter Massen, die unübersehbaren militanten Aktivitäten der Antifa und das Überspringen der Proteste nach Europa entsprechen zwar dem Muster anderer Proteste nach Polizeiübergriffen, stellen aber in Quantität und Qualität neue Rekorde auf.
Wenn man jede dieser Merkwürdigkeiten für sich alleine, und dann alle miteinander in Kombination hinterfragt, mit dem Ziel, herauszufinden, wer von jeder dieser Merkwürdigkeiten welchen Nutzen hat, lässt sich ein „geplantes“ Geschehen nicht mehr ausschließen.
Die Größe des Nutzens, nämlich die auf der Corona-Krise aufsetzende, zweite Welle der Destabilisierung der USA auszulösen, um die Wahlchancen Donald Trumps entscheidend zu schwächen, lässt dabei jeden Aufwand zur Vorbereitung gerechtfertigt erscheinen. Am Geld würde so ein Plan jedenfalls nicht scheitern. Selbst, dass man sich in Minneapolis entschlossen hat, lieber eine ganze Polizeiwache abbrennen zu lassen, als mit der gebotenen Härte einzugreifen, weist auf enorme Opferbereitschaft im Hinblick auf den erhofften Segen hin.
Auch in Deutschland hat man wunderbarerweise den Anti-Rassismus-Aufläufen freie Bahn gelassen. Verstöße gegen Abstandsgebote und die Pflicht zum Tragen von Masken wurden nicht geahndet. Jens Spahn ermahnte die Teilnehmer an diesen wichtigen Demonstrationen zwar, doch bitte ein bisschen auf die Hygiene zu achten, aber wer sich erinnert, dass kürzlich noch ein Waldspaziergang von fünf verwandten Personen, die allerdings nicht im gleichen Haushalt lebten, mit einem Bußgeld von 1.000 Euro belegt wurde (Artikel der Stuttgarter Zeitung), sieht eine „Unverhältnismäßigkeit“ der Reaktionen, bei der einem durchaus schwindelig werden kann.
Die Rassenhysterie in Deutschland ist Teil jenes Rassismus, der nicht mehr nach Hautfarbe, Sprache oder Religionszugehörigkeit geführt wird, sondern sich an einem einzigen Merkmal orientiert. Hier die unkritische Masse der Gerechten, dort die noch unterscheidungsfähigen, kritischen Denker, schon fast ausgestorben, bis auf die letzten Exemplare der Rasse der alten weißen Männer, von denen sich viele alleine durch das Mittel des Rassismusvorwurfes mundtot machen lassen.
Ramin Peymani schrieb heute auf seinem Blog „Liberale Warte:
„Es bereitet Sorge, dass die Angst der Politik vor der ANTIFA offenbar um ein Vielfaches größer ist als die vor Corona.“
Schön, wenn es diese Angst vor der Antifa tatsächlich gäbe, dann gäbe es nämlich bald keine Antifa mehr.