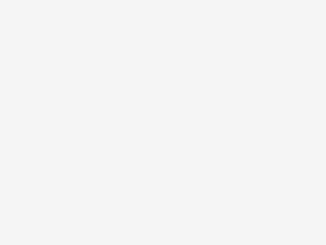PaD 6 /2021 Hier auch als PDF verfügbar: PaD 6 2021 Dienstleistungsgesellschaft unter Corona-Bedingungen
Den nachfolgenden Text habe ich vor ziemlich genau 10 Jahren, im Januar 2011 erstmals veröffentlicht.
Seinerzeit waren die Ökonomen und die Politiker überschwänglich damit beschäftigt, den Umbau der deutschen Volkswirtschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft zu propagieren, nachdem der Arbeitskräftebedarf der industriellen Basis aufgrund von Rationalisierungen und wegen der Konjunkturdellen die erst von der dot.com-Blase, dann von der Finanzkrise 2008 ausgelöst worden waren, weiter schrumpfte und der von Schröder und Hartz angekündigte „Niedriglohnsektor“ nicht ausreichte, um das Wachstum der realen Arbeitslosigkeit, die statistisch nach Kräften versteckt wurde, zu kompensieren.
Im Grunde bedeutet die Errichtung einer Dienstleistungsgesellschaft jedoch nur, dass diejenigen, die für den Produktionsprozess der Exportnation nicht benötigt werden, nicht mehr über die Instrumente der staatlichen Umverteilung (ALG I, ALG II, Sozialhilfe) alimentiert werden sollten, sondern auf direktem Wege von den Nutznießern der Dienstleistungen. Der Vorteil, der darin gesehen wurde, bestand darin, dass Steuern und vor allem Sozialversicherungsbeiträge niedrig gehalten werden konnten, während die bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten dadurch ersparten Beitragsaufwendungen, eingesetzt werden könnten, um damit Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Der maßgebliche Effekt allerdings sollte darin bestehen, die Exportindustrie nicht mit weiteren Personalkosten durch steigende Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zu belasten.
Im Sandkasten der hochaggregierten Modelle der Makro-Ökonomie erscheint das Spiel mit solchen Verschiebungen von Lasten durchaus sinnvoll und nützlich, weil ein mehr an Dienstleistungen durchaus auch als Wohlstandswachstum (nicht Reichtumswachstum) angesehen werden kann.
Welche Hindernisse dem in der kleinteiligen Realität gegenüberstehen, habe ich vor zehn Jahren in einem dreiteiligen Aufsatz dargelegt. Den ersten Teil stelle ich heute nochmals zur Diskussion. Die beiden weiteren Teile werden ich in Kürze ebenfalls noch einmal veröffentlichen.
Der Auslöser dafür liegt darin, dass im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, gerade dem so vielgepriesenen Dienstleistungssektor die größten Lasten auferlegt werden, mit der erkennbaren Tendenz, durch unzureichende Kompensation von Umsatz- und Einkommensausfällen gerade bei den kleinen Dienstleistungsunternehmen und den Einzelselbstständigen, den Handels- und Dienstleistungssektor wieder auszudünnen.
Das Kalkül könnte jetzt darin bestehen, den noch mit annähernd auskömmlichen Löhnen ausgestatteten Beschäftigten in den systemrelevanten Branchen, erst die Gelegenheit zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu nehmen, weil diese, aufgrund von Lockdowns (erste Stufe) und Geschäftsaufgaben und Insolvenzen (zweite Stufe) gar nicht mehr angeboten werden, um dann die eingesparten Konsumausgaben durch Steuer- und Beitragserhöhungen wieder einzuziehen, die dringend benötigt werden, um die aufgetürmten Schuldenberge abzutragen und die wachsende Zahl von Arbeitslosen mit dem Existenzminimum zu versorgen.
Soviel zur Einstimmung. Die aktuelle Situation vor Augen, wird der Paukenschlag aus dem Jahre 2011 helfen, das aktuelle Geschehen, das als ein Szenario der „Volksbewirtschaftung“ verstanden werden muss, besser einzuordnen.
Dienstleistungsgesellschaft
Utopie mit Charme (Teil 1)
Erstmals erschienen am 20. Januar 2011
Vorbemerkung
Wo von Politikern und ihren Experten öffentlich vom Umbau des Landes zur Dienstleistungsgesellschaft gesprochen wird, handelt es sich um eine kleine Mogelei. Der Umbau, um den es geht, ist der Umbau von einer überwiegend industriell geprägten Produktionswirtschaft zu einer Dienstleistungswirtschaft.
Die Verwerfungen, die dies in den gesellschaftlichen Strukturen hinterlässt, nimmt man als Kollateralschaden in Kauf. Das Ergebnis ist eine stark veränderte, vor allem ärmere Gesellschaft.
Die wahre Dienstleistungsgesellschaft, wie ich sie in diesem Aufsatz als „Utopie mit Charme“ zu skizzieren versuche, ist es etwas ganz anderes. Ebenfalls eine stark veränderte, vor allem aber eine glücklichere Gesellschaft.
Um den Unterschied deutlich machen zu können, muss eingangs auch die Beschaffenheit der öffentlich diskutierten „Dienstleistungsgesellschaft der Makroökonomie“, wie ich sie im Folgenden bezeichne, beleuchtet werden.
Die Dienstleistungsgesellschaft der Makroökonomie
Die Dienstleistungsgesellschaft der Makroökonomie ist die zwangslogische Folge von Produktivitätssteigerung und Marktsättigung.
Wo zur Erzeugung der lebensnotwendigen Güter,
als da sind Energie, Nahrung, Kleidung, Wohnungseinrichtung und Wohnraum,
und der zum normalen Lebensstandard zu zählenden Güter,
als da sind, Verkehrsmittel, Kommunikationsmittel sowie Spiel- und Sportgerätschaften,nur noch ein geringer Teil der erwerbsfähigen Bevölkerung benötigt wird – sagen wir 20% – bliebe – ohne die Dienstleistungsbranche – der Rest vom Erwerbsleben ausgesperrt und erzielte kein Erwerbseinkommen. Das wiederum würde – mangels Absatzmöglichkeiten – zum schnellen Zusammenbruch der hochgezüchteten Industrie führen.
Nun sind wir soweit, dass die Warenproduktion und das etablierte Dienstleistungsgewerbe samt öffentlichem Dienst nicht mehr in der Lage sind, die erwerbsfähigen und erwerbswilligen Personen in vernünftig entlohnte Beschäftigungsverhältnissen zu bringen.
Den Weg, die vielleicht noch 25 Millionen wirklich Beschäftigten (also ohne unfreiwillige Teilzeitarbeiter, ohne Mini-Jobber und Ein-Euro-Jobs, ohne Aufstocker und andere prekär Beschäftigte) so gut zu bezahlen, dass von ihren Einkünften – einerseits direkt innerhalb der Familie, andererseits darüber hinaus indirekt über Steuern und Beiträge auch die Alimentierung der übrigen (vermutlich) 55 Millionen Menschen in Deutschland ermöglicht würde, will man aus verschiedenen, zum Teil sogar nachvollziehbaren Gründen nicht länger gehen, obwohl dadurch Binnennachfrage wegfällt und die Auslastung der Produktionskapazitäten sinkt.
Die wichtigsten Gründe dafür seien hier kurz angesprochen:
- Einesteils will man – und das ist nur im Kontext einer dem Kapitalismus frönenden Gesellschaft nachvollziehbar – nur diejenigen von der Produktivitätssteigerung profitieren lassen, die das Geld dafür investiert haben.
Dies gelingt am besten dadurch, dass weite Teile der Produktion exportiert werden, was den Wegfall der Binnennachfrage leicht überkompensieren kann, denn:Umsätze im Binnenmarkt bedürfen der Binnenkaufkraft. Umsätze im Export gelingen, ohne dass die Kaufkraft durch gewinnschmälernde Lohnzahlungen erst geschaffen werden muss.- Andererseits will man – und das ist unter Gerechtigkeitsaspekten nachvollziehbar – denjenigen, der eine Leistung erbringt, stärker am Ergebnis dieser Leistung teilhaben lassen als den, der keine oder nur eine geringere Leistung erbringt.
Allerdings wird bei der Begründung für die daraus folgenden Maßnahmen gelogen. Wenn die Produktivität ausreicht, um mit einem Beschäftigten im produzierenden Gewerbe vier nicht in der Produktionswirtschaft Tätige (z.B. Kinder, Ehepartner, Rentner, Politiker, Soldaten, Lehrer, Wirtschaftsweise usw.) zu versorgen, muss niemand die Rente mit 67 verlangen, weil die Prognosen sagen, 2050 müssten zwei Erwerbstätige für einen Rentner aufkommen …
Es geht immer nur darum, wie die geschaffenen Waren unter der Bevölkerung verteilt werden, egal, wie viele Beschäftigte für ihre Herstellung benötigt werden.
Die reine „Umverteilungsgesellschaft“ erscheint ungerecht. Sie ist es auch, solange sie ungerecht organisiert und zur Steigerung des Ungerechtigkeitsempfindens auch noch falsch dargestellt wird.
Gerechtere Organisation einer Umverteilungsgesellschaft entstünde, wenn man damit aufhören würde, die Umverteilung fast ausschließlich auf der Einkommensseite stattfinden zu lassen, sondern stattdessen versuchen würde, die Umverteilung auf die Beschäftigungsseite zu verlegen, wie es durch eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeiten und das daraus folgende Anwachsen der Beschäftigtenquote durchaus bewerkstelligt werden könnte.
Dass dies heute (vorgeblich) nicht funktioniert, dass (vorgeblich) ganz im Gegenteil trotz Massenarbeitslosigkeit viele Arbeitsplätze unbesetzt bleiben, weil die entsprechend qualifizierten Mitarbeiter fehlen, hat weniger mit den genetisch vorbestimmten körperlichen und geistigen Fähigkeiten der Menschen zu tun als mit den seit vielen Jahren grob fahrlässig und zum Teil wohl auch vorsätzlich angerichteten Mängeln im Schul-, Bildungs- und Ausbildungssystem.
So sucht man heute also für die vom Produktionsprozess nicht benötigten Menschen mehr oder minder zwanghaft nach Möglichkeiten, sie irgendwie anderweitig zu beschäftigen – und weil bei allen diesen Beschäftigungen weder Lebensmittel noch Wohnungen, weder Kleider noch Mobiltelefone entstehen, davon schaffen schließlich schon die in der Produktion Beschäftigten mehr als genug, zwingt man sie in immer neue Dienstleistungen.
Der Wechsel zur Dienstleistungsgesellschaft in der Lesart der Makroökonomie ist daher zwangsläufig mit der Ausweitung des Dienstleistungssektors in immer produktionsfernere Dienstleistungszweige verbunden. Dazu gleich mehr.
Vorab muss aber noch ein anderer Gedanke in die Überlegung eingeführt werden, nämlich die Frage der Finanzierung der Dienstleistungen.
Man muss dem Lehrer, der als Dienstleister antritt, Scharen von Schülern auf das Leben vorzubereiten, für seine Arbeit Geld in die Hand drücken. Erst damit wird es ihm möglich, die Produkte der industriellen Erzeugung abzunehmen, also eine Wohnung zu mieten, Möbel zu kaufen, sich zu kleiden und zu ernähren, sich dann ggfs. ein kleines Auto zuzulegen, ein Notebook und ein Handy, sowie das Fahrrad, samt Helm und Schutzbrille, zur körperlichen Ertüchtigung.
Das ganze Geheimnis der „Dienstleistungsgesellschaft der Makroökonomie“ besteht also darin, die Kaufkraft der Volkswirtschaft so zu verteilen, dass sowohl die Beschäftigten im produzierenden Gewerbe wie die Beschäftigten im Dienstleistungsgewerbe ihren Anteil der Produkte und Dienstleistungen erwerben können. Dies erfordert zwingend die Bereitstellung einer ausreichenden Geldmenge.
Werden so viele Dienstleistungsjobs geschaffen, dass Vollbeschäftigung herrscht, dass also alle Erwerbsfähigen auch erwerbstätig sind, muss die übers Jahr verfügbare Kaufkraft aus Löhnen und Gehältern, Steuern und Sozialausgaben ausreichend groß sein und immer wieder neu so verteilt werden, dass die insgesamt erbrachte Leistung aus Produktion und Dienstleistungen vollständig abgenommen werden kann.
Unter diesem Aspekt unterscheidet sich die „Dienstleistungsgesellschaft“ in keiner Weise von einer reinen Produktionsgesellschaft, denn auch wenn alle Erwerbsfähigen unter den Bedingungen der Vollbeschäftigung ausschließlich damit befasst wären, Waren und Güter zu produzieren, müsste doch wiederum die gesamte Kaufkraft aus Löhnen und Gehältern ausreichen, um diese Waren und Güter abzunehmen.
Diese Übereinstimmung ist nicht verwunderlich, denn auch der Begriff „Dienstleistung“ ist vom Begriff „Produktion“ kaum zu unterscheiden. Ein paar einfache Fragestellungen sollen das verdeutlichen:
- Ist ein Marktforscher im Vertrieb eines Konsumgüterherstellers in der Industrie tätig?
Ja?Dann sollte ein Marktforscher, der im Auftrag des Konsumgüterherstellers in einem externen Marktforschungsinstitut arbeitet doch auch der Industrie zugerechnet werden – der wird jedoch zu den Dienstleistern gezählt.- Ist ein Unternehmen, dessen Geschäftszweck die Arbeitnehmerüberlassung ist, ein Dienstleistungsunternehmen? Ja?Sind seine Mitarbeiter, wenn sie in der Produktion eingesetzt werden, immer noch im Dienstleistungssektor tätig?
Die abstrakt gezogenen Grenzlinien zwischen Industrie und Dienstleistung lassen sich in der Realität nicht auffinden. Nur an den äußersten Rändern des Dienstleistungssektors, wo Horoskope erstellt und käufliche Liebe feilgeboten wird, wo fremde Hunde gegen Stundenhonorar ausgeführt und mehr oder minder hoch subventionierte Theater bespielt werden, findet „echte“ Dienstleistung statt.
Schon Fahrlehrer und Verkehrspolizisten dienen – überspitzt gesagt – im Grunde doch nur der Automobilproduktion, Lehrer und Ärzte versorgen die Produktion mit qualifizierten, arbeitsfähigen Mitarbeitern und erhalten die Konsumfähigkeit – bei wechselndem Produktspektrum – bis ins hohe Alter.
Es ist spannend, diesen Gedanken weiter zu spinnen und die Frage zu stellen, wem letztlich was nutzt …
Als Zwischenergebnis gilt es hier festzuhalten:
Die „Dienstleistungsgesellschaft“ der Makroökonomie ist im Grunde eine inhaltsleere Spruchblase.
Eine Blase, die nur deshalb noch nicht geplatzt ist, weil bisher niemand hineingestochen hat. Überall wo „Dienstleistungen“ für die Produktion und den Absatz der Produktion benötigt werden, werden sie auch angeboten und bezahlt. Ob die Dienstleistungen in den Produktionsbetrieben „inhouse“ erbracht oder ob spezielle Dienstleistungsanbieter eingeschaltet werden ist dabei ohne Belang. Es ändert nichts daran, dass nahezu alle Dienstleistungen letztlich Produktion und Konsum unterstützen. Damit sind übrigens, wie der wegen dieser Aussage zurückgetretene Bundespräsident Köhler und der mit dieser Aussage Furore machende Verteidigungminister zu Guttenberg bestätigen, selbstverständlich auch die Soldaten der Bundeswehr gemeint.
Die Ausweitung des Sektors in den Bereich weniger wichtiger oder gar vollkommen überflüssiger Dienstleistungen führt automatisch dazu, dass dieser Teil der Dienstleistungswirtschaft im Niedriglohnsektor angesiedelt wird, weil solche Dienstleistungen nicht dazu beitragen, Werte bzw. Konsumschrott zu schaffen, sondern lediglich dazu, eine freiwillige Umverteilung von Kaufkraft zu bewirken.
Man gönnt sich eine Dienstleistung, lässt sich im übertragenen Sinn „Federn in den Hintern blasen*)“, und holt mit dem dafür gewährten Entgelt einen Menschen aus den unwürdigen Bedingungen von Hartz IV um ihn in die unwürdigen Bedingungen des Hartz-IV-Aufstockers zu überführen.
*) Zitat aus dem Seligenstädter Löffelbuch von 1768
Die Dienstleistungsgesellschaft als Utopie mit Charme
Die Dienstleistungsgesellschaft die mir vorschwebt, ist nicht die Folge von Produktivität und Marktsättigung, sondern das Ergebnis von Gemeinsinn und heiterer Gelassenheit.
Gemeinsinn und heitere Gelassenheit kennzeichnen die Situation einer intakten Familie. Man steht füreinander ein, teilt das verfügbare Einkommen, plant gemeinsame Unternehmungen, toleriert kleine Eigenheiten, auch Schwächen, und freut sich am gemeinsam Erreichten.
In einer Familie bringt jeder ein, was er einzubringen vermag, und alle partizipieren. Das schließt gelegentliche Meinungsverschiedenheiten, auch Streit und Rangordnungskämpfe nicht aus, im Gegenteil, es ist normal, denn so eine Familie ist ja nichts Statisches. Geburten und Todesfälle, Heiraten und Scheidungen mischen die Familie immer wieder neu durch, schaffen neue Strukturen, verändern die Rollen.
Dass Familienmitglieder ausgeschlossen oder verstoßen werden, ist jedoch die seltene Ausnahme. Das Wissen um die Chance, wenn es ganz hart kommt, in „den Schoß der Familie“ zurückkehren zu dürfen, ist seit Menschengedenken der Rettungsanker für verlorene Töchter und Söhne.
Sobald unsere Gesellschaft jedoch Gruppen bildet, die über die Größenordnung von Familien hinausgehen, begibt sie sich allerdings auf den Weg zum absoluten Gegenteil von Gemeinsinn und heiterer Gelassenheit. Dabei ist sie bereits weit vorangekommen. Man steht nicht füreinander ein und teilt nur ungern mit anderen. Egoismus, Hektik und Getriebenheit dominieren überall das Bild. Das Schaffen hier und das Raffen da führen an anderer Stelle zu erzwungener Untätigkeit und Armut. Zusammenarbeit wird von höheren Instanzen angeordnet und organisiert, um die gemeinsam errungene Beute wird brutal und unfair gekämpft, Eigenheiten und Schwächen einzelner werden erbarmungslos ausgenutzt, gemeinsame Unternehmungen dienen letztlich stets geschäftlichen Interessen – ansonsten geht man sich – wo man kann – aus dem Weg. (… und alle Ausnahmen bestätigen nur die Regel.)
Ist eine Umkehr möglich, und wenn ja, wohin?
Das Gesetz von der Trägheit der Masse, das besagt, dass jedwede Veränderung von Geschwindigkeit und Richtung einer Masse einen entsprechendem Energieeinsatz erfordert, wirkt auch im nichtphysikalischen Raum. Gesellschaftliche Veränderungen erfordern hohen Kraftaufwand und einen langen Atem, für beides sind Einsicht und Veränderungswille unbedingte Voraussetzung.
Unterstellen wir zunächst,
Einsicht und Veränderungswille seien bei der Mehrheit der Bevölkerung vorhanden, eine Regierung würde gewählt, die sich die Stärkung des Gemeinsinns in einem Klima heiterer Gelassenheit auf die Fahnen geschrieben hat.Was könnte am volkswirtschaftlichen Mechanismus der Leistungsgesellschaft so verändert werden, dass sich nach und nach eine Gesellschaft herausbildet, die von Gemeinsinn und heiterer Gelassenheit geprägt ist?
Eines der größten Hindernisse, die diesem Ziel im Wege stehen, ist die sogenannte „Allokationskraft des Zinses“; will heißen, das Geld (Kapital) wird zuverlässig immer da eingesetzt, wo es sich – unter Berücksichtigung von Gewinnerwartung und Verlustrisiko – am besten rentiert.
Dies impliziert, dass es für sinnvolle, nützliche aber nicht gewinnversprechende Projekte kein Geld gibt, es sei denn, jemand geht mit der Sammelbüchse herum und appelliert an das soziale Gewissen seiner Mitbürger, oder der Geldgeber erhofft sich von seinem Entgegenkommen einen Vorteil, der weit über diesen Aufwand hinausgeht. Letzteres ist regelmäßig die Ursache dafür, dass Wahlversprechen, die Geld kosten, gelegentlich – und stets rechtzeitig vor der nächsten Wahl – tatsächlich in Angriff genommen werden. Aber eben längst nicht alle wünschenswerten Projekte kommen auf diese Weise der Realisierung näher.
Eine von Einsicht und Veränderungswillen beseelte Regierung wird natürlich versuchen, für wünschenswerte, nicht gewinnorientierte Projekte, das benötigte Geld zur Verfügung zu stellen. Ihr stehen dafür im herrschenden System drei Wege offen:
a) Steuererhöhungen
b) Kürzungen bei anderen Etatpositionen
c) NeuverschuldungSteuererhöhungen mindern die verfügbare Kaufkraft der Bevölkerung, Kürzungen bei anderen Etatpositionen wirken negativ auf die Beschäftigung und damit auf die Kaufkraft der Bevölkerung, und Neuverschuldung zwingt zu höheren Zinszahlungen, was entweder Steuererhöhungen oder Kürzungen oder neuerliche Neuverschuldung erforderlich macht.
Ein Teufelskreis.
Ein weiteres großes Hindernis liegt in der rätselhaften Eigenschaft des Staatsbudgets, niemals alle wünschenswerten Aufgaben finanzieren zu können.
Selbst die Tatsache, dass in einer Volkswirtschaft ausreichend viele erwerbsfähige und erwerbswillige arbeitslose Personen vorhanden sind, um alle gewünschten Projekte realisieren zu können, hilft nicht aus dieser Falle. Schließlich ist zu jedem Zeitpunkt gerade genug Geld in den öffentlichen Kassen, um das Arbeitslosengeld bezahlen zu können – da sprechen wir derzeit von Aufwendungen in der Größenordung von durchschnittlich 1.200 Euro pro Person und Monat, vorausgesetzt, man dividiert der Einfachheit halber den Etat der BA für das Jahr 2011 durch die Zahl der für 2011 im Jahresdurchschnitt prognostizierten Arbeitslosen.
Würden diese Menschen in der Wirtschaft beschäftigt, entstünden daraus Wirtschaftsleistungen im Wert von rund 5.200 Euro pro Person und Monat, vorausgesetzt, man bezieht hierfür das für 2011 erwartete BIP auf die im Jahresdurchschnitt erwartete Zahl der Beschäftigten.
Statt 42 Milliarden BA-Etat für 2.944.000 durchschnittlich als arbeitslos gemeldete Personen müssten für die von diesen erzeugte Wirtschaftsleistung rund 182 Milliarden, also 140 Milliarden mehr ausgegeben werden.
Dafür ist aber kein Geld da.
(Dafür ist nie Geld da, aber das steht auf einem anderen Blatt)Selbst wenn man unterstellt, dass aus der Mehrwertsteuer, den Ertragssteuern der Unternehmen, dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer der Beschäftigten und den Beiträgen zur Sozialversicherung etwa 70 Milliarden an den Staat zurückfließen, bliebe immer noch eine Deckungslücke von 70 Milliarden. Nur 15 Milliarden davon macht die Steigerung der Netto-Einkommen (nach MwSt.) der Beschäftigten aus, 55 Milliarden fließen in Kapitalerträge (= Allokationskraft des Zinses!) und Unternehmensgewinne (nach Steuern).
(Anmerkung: Vorleistungen/Material aus dem Binnenmarkt lassen sich mühelos auf blanke Lohnkosten und Kapitalkosten/Gewinne herunterbrechen, Vorleistungen/Material aus dem Ausland sind im BIP bereits berücksichtigt)
Natürlich kann der Staat auch nicht hergehen, und zur Realisierung seiner Projekte lauter gemeinnützige Unternehmen beauftragen. Die gibt es in dieser Zahl und in den benötigten Branchen gar nicht – und ins Leben rufen könnte sie der Staat auch nicht, weil sich alle übrigen Unternehmen (zu Recht) beschweren würden – einmal darüber, dass man ihnen die Aufträge wegnimmt, zum anderen darüber, dass ihnen nicht die gleiche steuerliche Behandlung zuteil wird.
Wir stehen also ratlos vor der Erkenntnis, dass der Staat sich in einer Lage befindet, die dem Problem Alexanders des Großen mit dem Gordischen Knoten ähnelt.
Wo auch immer man einen einzelnen Faden zu fassen bekommt und daran zieht, wird die Situation nur noch kritischer und verworrener.
Kreativitäts- und Problemlösungsfachleute raten in solchen Situationen dazu, den Betrachtungsrahmen zu erweitern, das Problem auf eine Meta-Ebene zu heben, neue unkonventionelle Ideen zuzulassen.
Alexander nahm sein Schwert und beendete damit die Existenz des tückischen Knotens. Kolumbus stellte das Ei auf, indem er das Oval zu diesem Zwecke mit geringem Kraftaufwand einseitig abplattete.
Beide besannen sich darauf, dass ihnen mehr Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, als die in den jeweiligen Problemstellungen üblicherweise zur Anwendung kommenden.
Um die „Utopie mit einem gewissen Charme“ in eine reale, auf Gemeinsinn und heiterer Gelassenheit beruhende Dienstleistungsgesellschaft zu überführen, ist es eben auch nicht genug, sich darauf zu beschränken, mit den althergebrachten Werkzeugen die immer gleichen untauglichen Versuche bis in alle Ewigkeit zu wiederholen.
Weder Steuererhöhungen noch Ausgabenkürzungen oder Neuverschuldung lösen das Problem nachhaltig, welches – am Beispiel dargestellt – darin besteht, dass der arbeitsfähige und arbeitswillige, aber arbeitslose Dachdecker und das schadhafte Dach der Schule gleichzeitig, am gleichen Ort nebeneinander existieren, ohne dass es – wie in der Elektrotechnik – zu einem Überspringen des Funkens und zu einem Ausgleich der Potentiale käme.
Abstrakt betrachtet heißt das Problem schlicht „Geldmangel“.
Hätten wir eine goldgedeckte Währung, ließe sich dem Goldmangel abhelfen. Man könnte die Arbeitslosen auf Goldsuche schicken – entweder mit Sieb und Schaufel an die Flüsse, mit Hacke und Pickel, Bohrer und Dynamit in die Bergwerke, oder mit Gewehr und Panzerfaust, Drohne und Stealth-Bomber über die Grenze zum Nachbarn, wo Gold in den Safes und Schmuckschatullen zu finden sein soll.
Haben wir aber nicht.
Unsere Währung kommt ohne Golddeckung aus. Das ist gut – und das ist schlecht. Gut, weil das Vorhandensein von Liquidität nicht durch die vorhandene Goldmenge begrenzt ist, schlecht, weil das Vorhandensein von Liquidität nun ausschließlich auf reinen Willkürakten beruht, auf die der Staat zwar keinerlei Einfluss hat, die er aber dennoch mit seiner ganzen Autorität und Macht verteidigt und schützt.
Wenn der Gott der Geldschöpfung streikt, wenn die sengende Sonne den letzten Rest Liquidität verdunsten und als Zins und Tilgung aufsteigen lässt, so dass die Felder verdorren, das Vieh verdurstet und die Menschen hungern, dann erklärt sich der Staat außerstande, selbst Regen machen zu können und legt die Hände schicksalsergeben in den Schoß.
Dabei gehört nicht viel dazu.
Papier bunt bedrucken, Konten führen, Kredite gewähren, das alles ist keine Hexerei. Das könnte jeder Staat selbst in die Hand nehmen. Mit ein bisschen Einsicht und gutem Willen gelänge das dem Staat weit effektiver als jedem Banker. Der Staat muss nämlich keine Gewinne bei seinen Aktionären abliefern.
Man könnte die gleichen Menschen damit befassen, dieselben Maschinen verwenden, man müsste nur die Regeln verändern, geringfügig, um gewaltige Veränderungen auszulösen.
Regeländerung 1
Geld sollte nicht mehr länger vorrangig der erhalten, dessen Vorhaben die größte Verzinsung erwarten lässt, sondern derjenige, dessen Vorhaben den größten Nutzen erwarten lässt.
Nutzen dabei verstanden als Wohlstandmehrung für die gesamte Gesellschaft, nicht als Geldvermehrung für einige wenige, wäre ein brauchbares Kriterium für Forschungs-, Investitions- und Betreiberförderung.
Regeländerung 2
Geld sollte nicht länger ausschließlich als rückzahlungspflichtiger Kredit in die Welt kommen, Geld sollte hin und wieder auch als „Geschenk“ geschaffen und vergeben werden.
Zum Beispiel dann, wenn damit eine Leistung ermöglicht wird, die nützlich ist, ohne dass jemand da wäre, der dafür bezahlt, die ermöglicht werden soll, ohne dass dafür Steuern erhöht, andere Ausgaben gekürzt oder Schulden aufgenommen werden müssen.
Nur ein Beispiel von Tausenden denkbaren:
Wir erleben in diesen Tagen einen peinlichen Rekord an Schlaglöchern auf allen deutschen Straßen, vom Flurbereinigungsweg bis zur Autobahn – und wir erleben die totale Unfähigkeit, diese Löcher mehr als notdürftig zu stopfen, weil kein Geld dafür da ist.
Ja sind wir denn wahnsinnig?
Drei Millionen Menschen gezählt arbeitslos – aber die Schlaglöcher können nicht repariert werden, weil die Liquidität abgeflossen ist?
Dann machen wir sie uns halt, die Liquidität.
Warum soll nicht allen betroffenen Straßenbaubehörden zugesichert werden, dass ihnen das Geld für die Bezahlung der Reparaturrechnungen von der Bundesbank püntklich überwiesen werden wird?
Angst vor Inflation?
Eine unbegründete Angst.