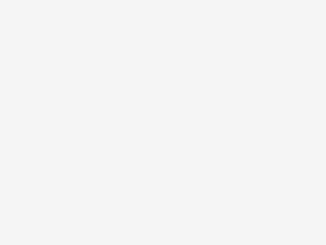Es mehren sich die Proteste gegen Billigimporte aus China.
Heute stimmt das Institut der deutschen Wirtschaft in das Klagelied ein.
Sonderbar! Das war doch über Jahrzehnte kein Problem, ganz im Gegenteil. Wir haben wie wild aus China importiert, weil die Sachen aus China so billig waren – und jetzt auf einmal soll die chinesische Regierung die Exporte ihrer Wirtschaft massiv subventionieren um uns zu schädigen?
Was ist anders geworden, und was ist unverändert geblieben?
Beginnen wir bei dem, was unverändert geblieben ist – und das seit Jahrmillionen.
Das ist unser hübscher blauer Planet. Alles, woraus dieser Planet besteht, von der Atmosphäre über das Wasser bis zum Erz in der Erdkruste ist – nach menschlichen Zeitmaßstäben – schon immer da, und zwar kostenlos. Umsonst. Ein Geschenk des Universums an die Erdbewohner. Erst spät in der Geschichte wurden Eigentumsrechte am Inventar des Planeten geltend gemacht. Die meisten dieser Eigentumsrechte wurden durch Mord und Totschlag, durch Betrug und Ausbeutung, vor allem aber durch Kriege begründet.
Je größer das Eigentum eines Eigentümers, desto größer seine Macht, die durch „Erpressung“ ausgeübt wird.
Nehmen wir den einfachsten Fall, nämlich den Grundbesitz. Wer gerade so viel Grund besitzt, dass er von dessen Früchten sich und seine Familie ernähren kann, verfügt damit kaum über ein Erpressungspotential. Wer aber zehn Mal, hundert Mal, tausend Mal mehr Grund besitzt, als er selbst bewirtschaften kann, und dem zehn, hundert oder tausend Familien gegenüberstehen, die über keinen eigenen Grund verfügen, der kann diese erpressen, indem er nämlich für die Erlaubnis, auf seinem Grund Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, eine Entschädigung verlangt. Der Bogen reicht von der Leibeigenschaft bis zur Pachtzahlung. Das kostenlos vorhandene Inventar des Planeten hat plötzlich einen Preis, der von den Eigentümern bestimmt wird.
Zur Arbeit, die notwendig ist, um den Boden einen Ertrag abzugewinnen, kommen die Kosten für die Nutzungsberechtigung.
Privateigentum an Grund und Boden gibt es in China nicht. Innerhalb der Städte gehört der Grund den Städten, der in einer Art Erbbaurecht von der Stadt vergeben werden kann und nach der Frist wieder an die Stadt zurückfällt. Grund und Boden außerhalb der Städte gehört den Kollektiven, die ihn wirtschaftlich nutzen. China ist groß und mit 150 Menschen pro Quadratkilometer deutlich dünner besiedelt als Deutschland mit 236 Einwohnern pro Quadratkilometer. China ist reich an Bodenschätzen, vieles, was in anderen Weltgegenden Mangelware ist, liegt in China in ausreichender Menge, wenn nicht gar im Überfluss vor. Teuer ist aber stets das Seltene.
Sie merken, worauf ich hinaus will:
Rohstoffe kosten in China nicht mehr als das, was an Arbeit aufgebracht werden muss, um sie zu fördern. Das ist ein erheblicher Kostenvorteil, der allerdings noch dadurch verstärkt wird, dass die Arbeit vergleichsweise billig ist.
Davon hat der Westen so lange fantastisch profitiert, wie es die Importeure aus dem Westen waren, die Rohstoffe, Vorprodukte und Halbzeuge in China billig eingekauft und zu Hause deutlich teurer verkauft haben. Man hat es dabei hingenommen, dass ganze Branchen im Westen ausgestorben sind, weil man mit billigen China-Importen weitaus bessere Geschäfte machen konnte als mit Erzeugnissen, die in der EU oder in den USA produziert wurden. Es war sogar möglich, die Lohnkosten im Westen niedrig zu halten, weil man den Arbeitnehmern für den geringen Lohn immer noch genug billige Waren aus China verkaufen konnte.
Dies alles wurde als „Segen der Globalisierung“ gepriesen.
Was hat sich verändert?
Die Chinesen haben ihre Exportpolitik verändert. Der Handel erfolgt in stärkerem Maße über chinesische Exporteure, die selbst in die westlichen Märkte eintreten und dabei weite Teile ihrer Kostenvorteile im Preis weitergeben. Ob es sich um Bekleidung und Accessoires von Ouku, um allerlei Heimwerkerbedarf von Temu, um Solarzellen für den deutschen Dekarbonisierungswahn oder gleich um E-Mobile chinesischer Hersteller handelt: Alle verzichten auf den westlichen Zwischenhandel und geben dessen Marge, bei steigenden eigenen Gewinnen, weitgehend an die Kunden weiter.
Natürlich ist das für die westlichen Konzerne ausgesprochen unangenehm. Es fallen Gewinne weg, die früher im Importgeschäft leicht zu erzielen waren. Andererseits ist es nicht möglich, die chinesischen Waren durch Produkte noch billigerer Anbieter zu ersetzen. Die gibt es einfach nicht. Und wo noch westliche Produzenten auf dem heimischen Märkten anbieten, ist es ihnen nicht möglich, über den Preis mit den Chinesen zu konkurrieren.
Volkswirtschaftlich betrachtet zeichnet sich ebenfalls ein Dilemma ab. Man kann die Chinesen zwar mit Strafzöllen vom eigenen Markt fernhalten, man kann das dann fehlende Anbebot aber nicht aus eigener Produktion ersetzen, weder zu den jetzt aufgerufenen chinesischen Billigpreisen, noch zu den Preisen zu denen chinesische Produkte bisher von westlichen Importeuren angeboten wurden.
Auch wenn es gerade opportun ist, in das Horn der USA zu tuten und China zum Feindbild zu stilisieren: Der freiwillige Verzicht auf chinesische Waren ist für die westlichen Volkswirtschaften vermutlich ebenso problematisch, wie der freiwillige deutsche Verzicht auf russisches Erdgas.
Solche schwerwiegenden Veränderungen kann man nicht übers Knie brechen, die müssen sorgfältig geplant und über eine ausreichend lange Zeitstrecke schrittweise umgesetzt werden, will man Schockwellen vermeiden.
Das Thema „Importsubstitution“ habe ich, bezogen auf eine mögliche deutsche Strategie, in meinem neuen Buch „Wie der Phönix aus der Ampel“ selbstverständlich auch behandelt. Einer der Grundgedanken lautet dabei: „Anfangen, wo es am einfachsten ist!“ Man kann billigen Stahl nicht selbst produzieren, wenn die notwendige Energie unbezahlbar ist, von grünem Stahl, mit grünem Wasserstoff erzeugt, braucht man da gar nicht erst zu reden. Dennoch wäre es sehr einfach, zuerst die teuren Energieimporte zu substituieren.
Ein kurzer Abschnitt aus dem Buch hilft, das zu verstehen:
Anfangen, wo es am einfachsten ist, heißt zweifellos, bei der Energieversorgung anfangen.
Es stehen uns immer noch viele funktionsfähige Kohlekraftwerke zur Verfügung, die vollständig stillgelegt oder als Reservekraftwerke ausgewiesen sind. Diese vorrangig wieder ans Netz zu bringen, um die inzwischen umfangreichen Stromimporte abzubauen, mit dem Ziel auf der Elektrizitätsseite wieder autark zu werden, wäre ein erster, schnell umsetzbarer Schritt.
Unklar ist, ob die zuletzt vom Netz gegangenen Atomkraftwerke noch reaktiviert werden können, oder ob sie nach dem „Verbrannte-Erde-Plan“ der Grünen bereits irreversibel zerstört sind.
Sicher ist jedoch, dass Deutschland über nennenswerte Erdgasfelder[1] verfügt, aus denen mindestens 36 Milliarden Kubikmeter mit einfachen Mitteln erschlossen werden könnten. Hinzu kommen 450 Milliarden Kubikmeter aus Kohleflözen und bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter aus Schiefergestein. Nur die sonderbare Konstruktion, Fracking-Gas aus den USA teuer zu importieren, die Erdgasförderung per Fracking in Deutschland aber zu verbieten, steht der Erschließung dieser Energiequellen im Wege. Das Verbot muss fallen, damit der LNG-Import entfallen kann.
[1] https://www.bveg.de/die-branche/erdgas-und-erdoel-in-deutschland/erdgasreserven-in-deutschland/
Damit ist das Thema Importsubstitution aber längst nicht abschließend behandelt. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, die weitere Abwanderung von Unternehmen ins Ausland zu stoppen und bereits abgewanderte zurückzuholen. Gleichzeitig sind Anreize für die Konsumenten zu schaffen, vermehrt Waren aus inländischer Produktion zu kaufen, zum Beispiel auch durch einen neuen Qualitätsstandard mit revolutionären Gewährleistungsregeln.
Aber lesen Sie selbst. Das Thema „Importsubstitution“ ist schließlich nur ein einzelnes Element im Plan zur Wiederauferstehung Deutschlands aus den Niederungen der Rezession.