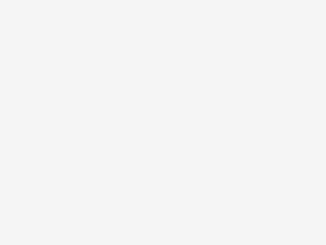Das Bürgergeld für Alleinstehende (ugs.: Singles) wird von 502 auf 563 Euro angehoben.
Damit stehen den Bürgergeldempfängern täglich 18 Euro und 51 Cent steuer- und sozialversicherungsfrei zur „freien“ Verfügung. Überschläglich gerechnet und unter Berücksichtigung der niedrigeren Sätze für Paare und Kinder kostet diese Unterhaltsleistung für Arme rund 33 Milliarden pro Jahr.
Weil daneben auch noch die Kosten für das Wohnen, also Miete und Heizkosten übernommen werden, die trotz Mietpreisbremse, Mietendeckel, und Energiekostenhilfen emsig weiter steigen, dürften die Wohlfahrtsausgaben des Staates damit spätestens ab 2024 mit rund 70 Milliarden Euro zu Buche schlagen.
Natürlich dürfen sich alle, die auf diese Leistungen angewiesen sind oder sich damit eingerichtet haben, über den damit gewährten Inflationsausgleich freuen. Gar keine Frage.
Das Leben in Deutschland ist teuer – und die Menge der für ein Zusatzeinkommen verfügbaren Pfandflaschen ist ebenso begrenzt wie die Lebensmittelspenden, die von den Tafeln verteilt werden können.
Da kann der Mensch, der noch ein Gewissen hat und zur Empathie fähig ist, doch gar nicht anders als großzügig zu geben. Auch jenen, die zwar Einwohner, aber nicht Staatsbürger sind und die inzwischen in der Kohorte der Bürgergeldempfänger mit einem Anteil von rund 40 Prozent in Erscheinung treten, weil es nach immer wieder bestätigten Erkenntnissen der Wissenschaft so etwas wie die aus der rechten Ecke kolportierten Pull-Faktoren überhaupt nicht geben kann.
Ich möchte diesem nur allzu menschlichen Versuch, wirklich jedem Menschen, der nichts für den eigenen Lebensunterhalt zu tun in der Lage ist, eine Grundabsicherung zuteil werden zu lassen, die zumindest ein Mindestmaß an Teilhabe ermöglicht, eine auf den ersten Blick krass und unmenschlich, wenn nicht gar menschenverachtend erscheinende Kritik entgegenstellen.
These:
Der Sozialstaat zerstört sich selbst umso wirksamer,
je umfassender er sich sozial engagiert.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Es ist unmöglich, den aktuellen Zustand des deutschen Sozialstaates per Kraftakt abzuschaffen und wieder verstärkt auf Selbstverantwortung zu setzen. Dafür sind viel zu viele Weichen in der Vergangenheit völlig falsch gestellt worden.
Aber: Die Idee, wie es anders, besser und gerechter sein könnte, ist in Deutschland inzwischen so weit in Vergessenheit geraten, dass es mir notwendig und sinnvoll erscheint, sie wieder einmal vorzustellen und ihren Nutzen zu begründen.
Dazu ist es zuerst erforderlich, zu begreifen, dass der Staat im ausufernden Sozialstaat neben seinen originären Aufgaben, nämlich Erhalt der staatlichen Ordnung nach innen und Herstellung der Verteidigungsfähigkeit nach außen, ganz überwiegend zu einem Umverteilungsmechanismus geworden ist, der es überwiegend von den abhängig Beschäftigten nimmt und dabei immer größere Teile der Umverteilungsmasse für sich selbst und seine Umverteilungsbürokratie beansprucht.
Die Bundszentrale für politische Bildung zeigt in einem Schaubild die Verteilung des Steueraufkommens nach Steuer-Arten für das Jahr 2021.
Ich greife hier nur jene Steuern heraus, die ganz oder ganz überwiegend vom „Kleinen Mann“, also von den Beschäftigten aus ihrem Einkommen aus abhängiger Beschäftigung aufgebracht werden.
| Steuerart | Mrd. Euro | |
| Lohnsteuer (Direktabzug vom Lohn) | 218 Mrd. | |
| Umsatzsteuer (MwSt. incl. Einfuhrumsatzsteuer) | 251 Mrd. | |
| Energiesteuer | 37 Mrd. | |
| Versicherungssteuer | 15 Mrd. | |
| Tabaksteuer | 15 Mrd. | |
| Kfz.-Steuer | 10 Mrd. | |
| Sonstige (Verbrauchssteuern) | 11 Mrd. | |
| Gemeindesteuern (ohne Gewerbesteuer) | 16 Mrd. | |
| Landessteuern | 32 Mrd. | |
| Summe | 605 Mrd. | |
| Anteil am Gesamtsteuer-Aufkommen von 833 Mrd. | 72,6 % | |
Müßig ist es, darauf hinzuweisen, dass die 228 Milliarden des Steueraufkommens, die dem „Kleinen Mann“ in dieser Betrachtung nicht zugerechnet werden können, letztlich nur dadurch entstehen können, dass der „Kleine Mann“ an der Ladenkasse, bzw. bei Vermietern und Dienstleistern, weite Teile seines Netto-Einkommens abliefert, was dazu führt, dass aus den Umsätzen – nach Abzug der Kosten – zu versteuernde Gewinne übrig bleiben. Natürlich spielen auch die Exportumsätze dabei eine Rolle, das soll nicht vergessen werden, aber dass der „Kleine Mann“ immer und überall als „Endabnehmer“ und damit als „Endbezahler“ auftritt, ist eine Tatsache, die mit lauteren Argumenten nicht zu widerlegen ist.
In einer anderen Betrachtungsweise könnte man sagen, dass die „Bestverdiener und die Reichen“ über ihre Steuern das bezahlen, was ihnen nutzt, nämlich im weitesten Sinne die Regierung, den öffentlichen Verwaltungsapparat und die Bundeswehr, während die steuerpflichtig Beschäftigten das bezahlen, was ihnen durch staatliche Leistungen und auf dem Wege der Umverteilung zugute kommt, wobei hier das Sozialversicherungswesen nur insoweit berücksichtigt ist, als es durch staatliche Zuschüsse (aus dem Steueraufkommen des „Kleinen Mannes!“) am Leben erhalten wird.
Was wäre, wenn?
Das unkomplizierteste Beispiel, das mir einfällt, beginnt mit der Frage:
Was wäre, wenn der Staat niemals damit begonnen hätte, „Wohngeld“ zu gewähren und den Hartz IV-/Bürgergeldempfängern die Kosten für die Miete zu erstatten?
Würden dann knapp 6 Millionen Menschen in Deutschland als Obdachlose unter Brücken und auf Parkbänken schlafen?
Es gibt einige Aspekte, die dies unwahrscheinlich erscheinen lassen.
- Es gibt immer noch so etwas, wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das zumindest im Verwandtschaftsbereich Lösungen ermöglichen würde, Menschen, die ansonsten ohne Wohnung dastehen müssten, mit in eine bestehende Wohnung aufzunehmen. Gerade erwachsene Kinder, die aus der elterlichen Wohnung schon einmal ausgezogen waren, würden dorthin zurückkehren, auch alleinerziehende Mütter kämen – samt Kind – höchstwahrscheinlich wieder bei den Eltern unter, bis sich eine bessere Gelegenheit ergibt. Umgekehrt könnten Armutsrentner, denen die Wohnung gekündigt wird, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können im Angesicht drohender Obdachlosigkeit, von ihren Kindern, vielleicht sogar von den Enkelkindern aufgenommen werden.
- Die Vermieter hätten es nie soweit kommen lassen, dass – aus heutiger Sicht mit 5,5 Millionen Berechtigten in schätzungsweise 3 Millionen Wohnungen – heute eben diese 3 Millionen Wohnungen leerstehen. Ob Wohnungskonzern, kommunale Genossenschaft oder private Kleinvermieter, der Druck auf die Mieten wäre gestiegen, und insbesondere am unterern Ende (Lage, Baujahr, Ausstattung, Zustand) wären Wohnungen zu Preisen vermietet worden, die den Möglichkeiten der Nachfrager entsprechen, also könnten beispielsweise für den schon abbruchreifen Altbau mit Ofenheizung und der Toilette auf dem Flur auch im Ballungsraum nicht 8 Euro/m² gefordert werden, die dann „vom Amt“ übernommen werden, sondern vielleicht nur 2 Euro/m². Dies würde wiederum ganz erheblich zur Entspanung der sozialen Lage beitragen. Viele Mieter, die es heute nicht können, könnten sich das Wohnen wieder leisten.
- Niemand will seinen Verwandten länger und intensiver auf der Tasche liegen als unbedingt notwendig, und wo dieser Wunsch nicht aus eigenem Antrieb entsteht, entstünde doch ein nicht unerheblicher Druck auf die Menschen ohne eigenes Einkommen, sich zu bemühen, bald wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Die heute festzustellende Tatsache, dass es für die Masse der erwerbsfähigen Arbeitslosen keinen Job gibt, während ausländische Fachkräfte dringend gesucht werden, hätte sich so möglicherweise auch nicht ergeben, hätte der Sozialstaat nicht damit begonnen, die Vermieter zu subventionieren. Ja. Sie lesen richtig. Alle Sozialleistungen für das Wohnen sind ja im Endeffekt Subventionen für die Vermieter, mit dem Nebeneffekt, dass der Anreiz für die Arbeitsaufnahme reduziert wird. Wer sich mit Bürgergeld und Mietkostenübernahme nicht schlechter stellt, als jemand der in Teilzeit mit 80 bis 100 Stunden im Monat zum Mindestlohn beschäftigt ist, wäre doch blöd, würde er ersthaft eben diese Arbeit anstreben. Stünde er aber vor der Wahl, entweder noch länger mit den Eltern im ehemaligen Kinderzimmer zusammen zu leben, oder doch wieder in der eigenen Wohnung nach eigenen Vorstellungen zu leben, wäre der Job die Lösung.
Ich meine, es würde funktionieren. Der Wohnungsmarkt würde sich ganz von alleine nach den Gesetzen des Marktes neu einpendeln.
Was wäre, wenn?
Das Argument, dass es die Jobs nicht gibt, und dass bei solchen Mieten im untersten Segment auch die Mieten der besseren Wohnungen nachgeben müssten und dass dies alles dazu führt, dass der Wohnungsbau noch stärkter schrumpft, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber das ist Folge der vielen seit vielen Jahren falsch und immer falscher gestellten Weichen.
Was führt denn dazu, dass es die Jobs nicht gibt, und was führt dazu, dass sich aus Vermietung immer schwerer vernünftige Renditen erwirschaften lassen?
Bei den Jobs gibt es auf diese Frage gleich eine ganze Reihe von Antworten. Die erste, alles entscheidende Antwort, lautet: Es gibt die Jobs durchaus, es herrscht Fachkräftmangel. Das Problem ist die Qualifikation der Bewerber. Falsch gestellte Weichen in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass ein volkswirtschaftlich katastrophales Bildungsideal eine Schwemme von Akademikern, insbesondere außerhalb der MINT-Fächer hervorgebracht hat, die allenfalls für Jobs in der öffentlichen Verwaltung und als Beauftragte für dies und das zu gebrauchen sind, aber nicht für Jobs in werteschaffenden Branchen. Gleichzeitig hat man die schulischen Anforderungen gesenkt, um immer mehr Jugendlichen den Zugang zum Abitur und zum Studium zu ermöglichen, was dummerweise – und in Verbindung mit der unzureichenden materiellen Ausstattung der Schulen – dazu führte, dass in vielen Fällen selbst die Mittlere Reife nicht mehr genügt, um als Basis für eine Berufsausbildung zu dienen, vom Hauptschulabschluss ganz zu schweigen. Für die Ausbildungsbetriebe ist andererseits mit den von den Tarifpartnern festgelegten Ausbildungsvergütungen, die in keinem Verhältnis mehr zu dem stehen, was die Auszubildenden drei Jahre lang an Kosten verursachen, ohne dafür eine adäquate Leistung zu erbringen, der Anreiz, selbst auszubilden immer weiter gesunken. Man hat versucht, lieber die bei der Konkurrenz ausgebildeten Leute abzuwerben, in der Probezeit festzustellen, ob sie tatsächlich können, was das Zeugnis verspricht, um sie dann entweder zu übernehmen oder wieder gehen zu lassen. Berufsqualifikation im hochgelobten, deutschen dualen System hat inzwischen die Form eines „Schwarzer-Peter-Spiels“ angenommen, das mit nachlassendem Wachstum und dem Übergang in die Rezession immer dramatischer wird.
Jobs, bei denen es weniger auf die Qualifikation ankommt, als vielmehr auf Kraft, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, gibt es nicht mehr, weil der Mindestlohn, selbst wenn er nicht staatlich festgesetzt wäre, eine Einstellungsbarriere darstellt. Es hatte sich ja – vor dem gesetzlichen Mindestlohn – längst ein Mindestlohn herausgebildet, unterhalb dessen niemand – auch nicht schwarz – zu arbeiten bereit war. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es in den Supermärkten Beschäftigte, die Leergut angenommen und den Pfand ausgezahlt haben, es gab Menschen, die ganztags über den Parkplatz zogen und die Einkaufswagen eingesammelt und wieder an ihren Platz gebracht haben. Beide sind verschwunden. Das Leergut nimmt ein Automat an, der für rund zwanzigtausend Euro zu haben ist (gebraucht schon ab 5.000). Nimmt man an, dass sich der Automat innerhalb von fünf Jahre amortisieren soll, dann sind das jährliche Abschreibungen von 4.000 Euro. Nehmen wir großzügig noch den Strom dazu und Wartungskosten, und rechnen mit 5.000 Euro p.a., dann sind das auf den Monat bezogen 417 Euro und bei 22 Öffnungstagen mit 10 Stunden Einsatz bleict für einen Leergutannehmer ein konkurrenzfähiger Stundenlohn von 1,89 Euro. Für den Wagenschieber auf dem Parkplatz kommt ein ähnlicher Stundenlohn heraus.
So mancher Flaschensammler würde vermutlich einen solchen Job annehmen, weil das Zubrot damit zuverlässig gesichert wäre, doch der Supermarkt müsste heute, wollte er ein legales Arbeitsverhältnis begründen, eben 12,50 Euro pro Stunde auswerfen, abgesehen vom Verwaltungskram, der damit verbunden ist, und wird jeden, der sich als Mitarbeiter für 2 Euro pro Stunde anbieten sollte, mit Bedauern ablehnen müssen.
Soviel zu den Jobs, die es gibt und doch nicht gibt. Was ist mit den Wohnungen, die es nicht gibt und die auch nicht gebaut werden?
Auch hier begnen wir dem Monstersozialstaat. Einerseits will er, dass sich jeder eine angemessene Wohnung leisten kann. Weil er aber nicht dafür sorgen kann, dass die Löhne und Gehälter ausreichen, um die Miete aufzubringen und noch genug zum Leben übrig zu behalten, selbst da nicht, wo er selbst als Arbeitgeber in Erscheinung tritt, greift er am anderen Ende ein, nämlich bei der Begrenzung der Miethöhe. Besonders progressive Sozialpolitiker fordern darüber hinaus auch noch die Enteignung der Wohnungskonzerne. Wer investiert da noch in Wohnraum? Vor allem dann, wenn die Bauvorschriften dazu führen, dass das Bauen um Vieles teurer wird als es sein müsste, hegte der Staat im Wohnungsbau nicht auch noch ganz andere Interessen, die dem Narrativ des menschengemachten Klimawandels entlehnt sind. Teuer bauen, aber nicht zu den erforderlichen Mieten anbieten dürfen und ggfs. noch die Enteignung hinnehmen zu müssen: Das ist fürwahr kein Investitionsanreiz. Das dämmert inzwischen sogar der Wohnungsbauministerin Geywitz, die zumindest vorgeschlagen hat, die nächste Verschärfung der Vorschriften (EH 40 ab 2025) auf später zu verschieben. Doch gleichzeitig sorgen die allgemeinen Kostensteigerungen am Bau und die ansteigenden Zinsen dafür, dass dieser Vorstoß wirkungslos verpuffen dürfte.
Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn nicht nur die Kosten für das Wohnen, sondern – von wenigen Ausnahmen abgesehen – auch keine Grundsicherung/Bürgergeld gezahlt würde?
Wie bereits angesprochen: Das ist schlicht nicht mehr möglich. Nicht nur, weil die Regierung, die das umsetzen wollte, die nächsten Wahlen nicht überstehen könnte, vor allem, weil das gesamte soziale Gefüge der Republik in sich zusammenbrechen würde.
Ein soziales Gefüge, das mittels eines weit gespannten und dicht gewebten sozialen Netzes, dazu dienen sollte, eine sozial weitgehend gleiche Gesellschaft auf hohem Niveau der materiellen Versorgung hervorzubringen und dabei der erwünschten Nivellierung tatsächlich Schritt für Schritt näherkommt, aber eben nicht auf hohem, sondern auf immer weiter sinkenden Niveau. Am besten zum Ausdruck gebracht mit dem Wehgeschrei: „Uns geht der Mittelstand verloren!“
Es lässt sich aber ein eindeutiger Sachverhalt durchaus ableiten.
Hätten wir kein nahezu bedingunglos gezahltes Bürgergeld, könnte der Staat in erster Näherung die oben ermittelten 70 Milliarden Euro in der Lohntüte der rund 35 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten belassen. Das wären durchschnittlich immerhin 2.000 Euro jährlich pro Nase. Zudem würden die Mieten sinken, während sie gleichzeitig für die entlasteten Beschäftigten bezahlbarer würden.
Nehmen wir den Wegfall von vermeintlich aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit errichteten Beschäftigungshindernissen hinzu, ließe sich damit ein zwar kleiner, aber insgesamt motivationsfördernder Aufschwung auslösen.
Ich weiß, das ganze Thema ist bisher nur am Rande gestreift, soll mit diesem Aufsatz aber auch nicht weiter vertieft werden. Es ist ein Denkanstoß, den ich, wenn ich ihn schon nicht vertiefe, wenigstens noch ein bisschen erweitern will.
Der Staat, der über seinen Versuch, maximal sozial zu sein, die Kontrolle über seine Finanzen verloren hat, beschreitet seit Jahren einen weiteren Irrweg, nämlich den untauglichen Versuch, den Zuwachs seiner Verschuldung durch die Privatisierung der Infrastruktur der Grundversorgung zu bremsen. Es wurden massenhaft Wohnungsbestände der öffentlichen Hände verscherbelt. Die Folgen waren von vornherein absehbar, und sind nun in voller Hässlichkeit eingetreten. Die öffentlichen Hände haben, was ich als noch schlimmer betrachte, ein Krankenhaus nach dem anderen an private Betreibergesellschaften verhökert und treiben mit dem Zwang zu einer betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Rechnung auch noch die letzten kommunalen Häuser in den Ruin. Die krankhaften Bemühungen des amtierenden Gesundheitsministers, mit einer neuen Reform die stationäre Versorgung noch mehr zu konzentrieren, um vermeintlich positive Effekte aus einer hohen Kapazitätsauslastung ziehen zu können, lassen für die Zukunft der deutschen Krankenhäuser Schlimmes befürchten. Ähnliches vollzieht sich bei den Pflegeeinrichtungen, wo der Staat sich aus der Finanzierung der Investitionen, zu der er eigentlich verpflichtet ist, weitgehend zurückgezogen hat, um privaten Investoren zu Lasten der Pflegebedürftigen und der Pflegenden satte Renditen zu ermöglichen, die – und das ist die Crux und der Grundgedanke dieses Aufsatzes – auf dem Umweg über die Bedürftigen aus den Taschen der Steuerzahler auf die Konten der Investoren gelangen.
Den Sozialstaat zu reformieren, kann sich nicht im Streichen von Leistungen erschöpfen. Wenn, dann muss das gesamte System von lähmenden Vorschriften und lieb gewonnenen Besitzständen entrümpelt werden, bis das hehre Wort von der Selbstverantwortung auch den Freiheitsrahmen findet, innerhalb dessen es sich tatsächlich voll entfalten kann.