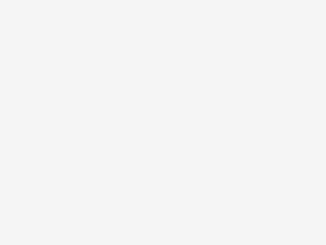PaD 39 /2020 Corona: Ist Weihnachten noch zu retten? Hier auch als PDF verfügbar:
PaD 39 2020 Corona Ist Weihnachten noch zu retten
Wenn deutsche Politiker versuchen, etwas zu retten, wird es meistens teuer.
45,75 Millionen Christen lebten 2019 in Deutschland. Das sind rund 55 Prozent der Bevölkerung, und von diesen 55 Prozent wissen wir zumindest, dass sie sich allesamt einmal im Jahr, nämlich am 24. Dezember, auf das Fundament ihres Glaubens besinnen und Familie, Verwandtschaft, ja selbst Freunde und Bekannte beschenken. Das geht ins Geld. 14 bis 15 Milliarden Euro Extra-Umsatz entfallen ungefähr auf das Weihnachtsgeschäft und die mit Silvester zusammenhängenden Einkäufe. Dies sind, bei Licht betrachtet, allerdings peanuts von peanuts im Vergleich mit jenen Summen, die jetzt zur Weihnachtsrettung aus der leeren Kasse auf den Tisch des Hauses gepackt werden.
Um das Weihnachtsgeschäft zu retten, haben deutsche Politiker am Mittwoch beschlossen, alles, was außer Haus Spaß macht, für die Zeit vom 2. bis zum 30. November zu verbieten. Da bisher noch nie versucht wurde, das Weihnachtsgeschäft zu retten, ist der Ausgang dieser Maßnahme vollkommen offen. Ich wage allerdings zu prognostizieren, dass der Einzelhandel allenfalls noch zwei Drittel des gewohnten Weihnachtsgeschäftes verbuchen wird, wovon wiederum zwei Drittel auf den Versandhandel entfallen werden, und davon zwei Drittel auf jenen Prime-Versandhändler, der seine Mitarbeiter in Deutschland ebensowenig nach Tarif bezahlt, wie er seine Gewinne im gleichen Maße versteuert, wie es dem stationären Einzelhandel abverlangt wird.
Natürlich hat keiner gesagt, dass das Weihnachtsgeschäft gerettet werden solle.
Das wäre nämlich eine ziemlich klare Zielsetzung gewesen für man sich sehr zweckmäßige und zielführende Maßnahmen hätte ausdenken können. Hat Donald Trump den US-Bürgern nicht mal eben so den Betrag von 1.000 $ geschenkt, damit der Konsum nicht einbricht, wegen Corona? Die Hoffnung auf Helikoptergeld können wir Deutschen uns abschminken. Das Kurzarbeitergeld ersetzt den Lohnverlust nicht vollständig, und was man von den Hilfen für Selbstständige und Unternehmern hört, ist auch nicht berauschend. Es kommt da weit weniger an als man nach den vollmundigen Versprechungen glauben könnte. Nee – wenn wir Deutschen leiden, dann leiden wir mit Anstand und Größe in aller zumutbaren Bescheidenheit. Schließlich mussten sich die hochschwangere Maria und der sie begleitende Joseph ja auch mit einer zugigen Hütte zufriedengeben, beheizt mit der von Ochs und Esel abgestrahlten Biowärme. So fing Weihnachten an. Mehr braucht es nicht, zum Glücklichsein.
Damit ist hinlänglich begründet, dass es deutschen Politikern auf das Weihnachtsgeschäft und den ach so oft beklagten Konsumrausch wirklich nicht ankommt.
Was aber wollen sie wirklich retten?
Geht es um die Vorstellung von Millionen von Geschenkpapier zerfetzenden Familien im milden Glanz der blinkenden LEDs am Tannenbaum? Um Jingle Bells around the clock? Um die Weihnachtsgans, den Christstollen, die Lebkuchen und den sündhaft teuren Armagnac in der Geschenkpackung mit einem mundgeblasenen Schwenker dazu? Geht es um die Mitternachtsmette in der als Geheimtipp gehandelten, tief verschneiten, einsamen Kapelle im oberbayrischen Bergland mit garantierter Vorbeifahrt jenes rotlackierten Trucks mit dem als Santa Claus kostümierten Brausevertreter am Lenkrad?
Vermutlich ist es das. Aber kann dieses rettungslos kommerzialisierte Fest des protzig auf Pump beschafften Überflusses überhaupt noch gerettet werden? Ist es überhaupt wert, in dieser Form gerettet zu werden?
Fest steht, die „wahre Weihnacht“ kann kein Politiker retten. Die findet im Herzen statt und braucht weder Glühwein noch einen vom ZDF produzierten Weihnachts-Dreiteiler.
Damit darf knallhart gefolgert werden: Das Gerede davon, dass wir uns jetzt in vielerlei Hinsicht einschränken müssen und uns dem allgemeinen, bundesweiten Hausarrest fügen müssen, damit Weihnachten 2020 von uns vollkommen frei und unbeschwert nach unseren Vorstellungen gefeiert werden kann, ist der Speck, mit dem man Mäuse fängt. Und weil dieser Speck so christlich riecht, handelt es sich nicht um eine profane, sondern um eine fromme Lüge, die gleiche fromme Lüge, mit der man dem Sterbenden versichert, er werde garantiert wieder gesund und noch viele Geburtstage im Kreise seiner Lieben feiern können.
Was würden die Meister des Framings und Nudgings wohl als Begründung heranziehen, wenn die steil ansteigenden Zahlen erst im Januar oder Februar auftreten würden? Wir müssen Ostern retten? Wir müssen Pfingsten retten?
Was wir erleben ist eine überaus peinliche Form der Kommunikation mit der Bevölkerung, der man die Wahrheit, wenn überhaupt, dann nur scheibchenweise zumuten mag.
Es geht nicht um Weihnachten.
Auf Basis der konkreten aktuellen Corona-Situation in Deutschland und aufgrund des inzwischen angewachsenen Wissens sowohl über die Krankheit, was Dauer, Intensität und Verlauf betrifft, als auch über die Qualität und Aussagekraft der Tests, die zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden und die verfügbaren medizinischen Kapazitäten lässt sich mit relativ hoher Genauigkeit vorhersagen, wo wir in Deutschland ohne zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schon Ende November stehen würden:
Täglich über 100.000 Neuinfektionen, akut 60.000 Patienten mit schweren Verläufen in stationärer Behandlung, weitere 12.000 auf den Intensivstationen und noch einmal 7.500 unter künstlicher Beatmung, sowie täglich rund 300 Covid-Todesfälle.
Das sind die Größenordnungen, über die Merkel, Söder, Laschet, Ramelow und all die anderen Ministerpräsidenten am Mittwoch gesprochen haben.
Dabei muss klar sein, dass die Zahl der für Ende November prognostizierten Todesfälle mit hoher Wahrscheinlichkeit erreicht werden wird. Die Menschen, die Ende November an Covid 19 sterben werden, werden sich am 2. November, wenn die verschärften Maßnahmen in Kraft treten, bereits infiziert haben. Die sind alle noch unter uns, die meisten noch beschwerdefrei, doch ihre persönliche Konstitution und die aufgenommene Virenlast haben ihr nahes Schicksal bereits vorgezeichnet.
Die Belastung der Kliniken mit Covid-Patienten wird etwas zurückgehen, weil der Zulauf an Patienten etwa um die Monatsmitte seinen Höhepunkt überschritten haben wird und von da an ganz allmählich wieder zurückgeht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die verschärften Maßnahmen vom ersten Tag an die Zahl der Neuinfektionen allmählich reduzieren, was sich aber erst nach etwa zwei Wochen auf die Hospitlasierungsrate auswirken wird.
Wie stark die Zahl der Neuinfektionen ab dem 2. November sinken wird, ist sehr schwer abzuschätzen. Hier wirken mehrere Faktoren zusammen, nämlich:
- Unternehmen sollen regulär weiterarbeiten, soweit die Betriebe entsprechende Hygiene-Konzepte aufstellen und umsetzen. Wir sprechen dabei von rund 40 Millionen Menschen, die pro Woche während rund 40 Arbeitsstunden mit Kollegen und ggfs. Kunden in Kontakt kommen, zum Teil in relativ engen – und nicht immer optimal zu belüftenden Räumen. Hinzu kommen bei vielen unterschiedlich lange Wegezeiten in zu den Stoßzeiten gut besetzten öffentlichen Verkehrsmitteln.
- Schulen und Kitas sollen für den Präsenzunterricht geöffnet bleiben. 3 Millionen Kinder unter 6 Jahren besuchen Betreuungseinrichtungen, 8,3 Millionen Schüler besuchen allgemeinbildende Schulen, fast 2,9 Millionen Studenten finden sich an den Hochschulen ein. Insgesamt also rund 14 Millionen Menschen, die wöchentlich rund 25 Stunden in kleineren und größeren Verbänden in Kontakt geraten, und von denen ein Teil wiederum auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist.
- Nicht Erwerbstätige, die sich frei bewegen können, also nicht in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Gefängnissen verwahrt werden, bilden eine Gruppe von rund 30 Millionen Menschen, von denen wiederum – trotz „Hausarrest“ – ein nicht unerheblicher Anteil häuslichen Kontakt zu Beschäftigten und/oder Schülern hat.
- Einkaufen, Arztbesuche, etc. das sind Aktivitäten die nur in Bezug auf die gleichzeitig in einem Geschäft oder einer Praxis zulässige Personenzahl beschränkt werden. Selbst bei allervorsichtigster Schätzung werden sich hier wöchentlich um die 40 Millionen Menschen für mindestens eine Stunde in Geschäften begegnen und dort mit einigen anderen die gleiche Luft atmen.
Selbst unter der Annahme, dass auch die hartgesottensten unter den Querdenkern und ihrem Anhang die Maßnahmen akzeptieren und einhalten würden, bleibt also ein beträchtliches Potential an Ansteckungsmöglichkeiten erhalten.
Der „Lockdown light“ ist nicht geeignet, das Virus „auszuhungern“.
Der „Lockdown light“ hat seinen Ursprung in der Unterscheidung zwischen dem Angenehmen und dem Nützlichen, wobei das Angenehme, ungeachtet des damit verbundenen Risikopotentials unterbunden wird, während das Nützliche, ungeachtet des damit verbundenen Risikopotentials (verpflichtend) erlaubt bleibt.
Ein derart pauschalisierend eingreifender Utilitarismus mag formal das Zeug haben, im Wettbewerb der schönsten faulen Kompromisse einen Preis zu gewinnen, doch die mangelnde Differenzierung mindert einerseits die breite Akzeptanz in der Bevölkerung und andererseits den Grad der Eindämmung der Weiterverbreitung des Virus. Dass die Ursachen für diese pauschalen und daher suboptimalen Maßnahmen nicht nur in der fehlenden epidemiologischen, psychologischen und systemtechnischen Kompetenz der Entscheider liegen, deren ideologische Vorprägung es zudem erschwert, dem Rat von Experten vorbehaltlos zu folgen, sondern dass in hohem Maße auch die Frage der „Kontrollierbarkeit“ und „Durchsetzbarkeit“ die Ausgestaltung der Maßnahmen beeinflusst, stärkt vor allem den Widerstand jener, die sowieso bereits im durchaus gerechtfertigten Kampf gegen ein Übermaß staatlicher Bevormundung, Überwachung und Kontrolle stehen.
Der „Lockdown light“ wird sein eigentliches Ziel, nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems kurz vor Erreichen der absoluten Schmerzgrenze noch abzuwenden, vermutlich mit Müh‘ und Not erreichen. Der von Freitag auf Mittwoch vorgezogene Krisengipfel und der vom 4. auf den 2. November vorgezogene Termin für das Inkrafttreten der Maßnahmen und die überraschende Einigkeit der Ministerpräsidenten lassen da ganz eindeutig auf das „Fünf-vor-zwölf-Syndrom“, bzw. die aufflammende „Torschlusspanik“ schließen.
Weihnachten 2020 kann jedoch nicht mehr gerettet werden.
Ich tippe darauf, dass man beim nächsten Krisengipfel in Anbetracht der dann vorliegenden, nur mäßig positiven Zahlen, ernsthaft die Verlängerung bis Ende Dezember in Betracht zieht, die Entscheidung jedoch noch unter den Vorbehalt der Ende November vorliegenden Zahlen stellen wird. Ende November werden wir jedoch in Bezug auf die Zahl der Neuinfektionen bestenfalls wieder auf dem Stand von Ende Oktober angekommen sein, in Bezug auf die Belegung der Intensivbetten trotz Rückgang noch deutlich über diesem Stand liegen. Unter diesen Voraussetzungen gibt es nicht den geringsten Anlass, in den Anstrengungen zur Überwindung de Pandemie nachzulassen, denn die glücklicherweise bis dahin erreichten Zahlen waren doch gerade vier Wochen vorher der Anlass zu größter Besorgnis und der Auslöser des „Lockdowns light“. Anzunehmen, dass der dann zu erkennende positive Trend in keinem Zusammenhang mit den Maßnahmen stehe und sich nun von alleine fortsetzen werde, weil ja auch jede Grippewelle bisher irgendwann von alleine abgeklungen ist, gehört in den Bereich des Wunderglaubens. Als Maxime des Regierungshandeln müsste man es als kriminell, zumindest als maximal verantwortungslos bezeichnen.
Allerdings weist die ja durchaus der Realität menschlichen Verhaltens nachempfundene Psychologie des Katastrophenfilms, ganz unabhängig von der Art der darin heraufbeschworenen Gefahr, darauf hin, dass es der steten Eskalation der Katastrophe bedarf, bis die Warnungen der Experten von den Verantwortlichen nicht mehr leichthin in den Wind geschlagen werden sondern die Entwicklung abwartend beobachtet wird, bis ganz zum Schluss jene Entscheidungen getroffen werden, für die das Häuflein der Überlebenden ewige Dankbarkeit zollen wird.
Jetzt die Hoffnung auf ein von der Pandemie vollkommen unbeeinflusstes Weihnachtsfest zu schüren und sich damit die Zustimmung zu den Maßnahmen erkaufen zu wollen, entstammt der Trickkiste der Werkzeuge der Massenmanipulation, ebenso wie einst der Glaube an den Endsieg geschürt wurde, um auch noch Rentner und Schüler für den Landsturm begeistern zu können.
Wer früh, oder auch nur im letzten sinnvoll erachteten Moment, die richtigen Maßnahmen trifft und damit die Katastrophe abwendet, wird immer nur die Anklage ernten, er habe mit seinen Maßnahmen weit mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet, denn schließlich sei die Katastrophe, wie von den meisten vorhergesagt, überhaupt nicht eingetreten. Erdbebenwarnungen sind das klassische Beispiel. Evakuieren, oder nicht evakuieren? Warnen – und eine Panik auslösen, oder schweigend abwarten?
Typisch für viele Gegner der staatlichen Eingriffe zur Eindämmung der Pandemie ist die Einstellung eines Lesers meines Blogs, mit dem sich in den letzten Tagen ein munterer Mailwechsel entwickelte. Dreimal in Folge richtete ich an ihn die Frage, wie er denn, säße er an der Stelle seines hessischen Ministerpräsidenten Bouffier, wohl agieren würde. Zweimal ist er nicht darauf eingegangen – bei der dritten Anfrage meinte er:
Ich würde in Protest zurücktreten mit den Worten von Horst Seehofer: „Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“
Den Maßnahmen der Verantwortlichen kritisch zu begegnen, gehört zu den Spielregeln der Demokratie. Sinnvoll wird Kritik aber erst, wenn sie auch konstruktive Elemente enthält, wenn also dem für falsch erachteten Vorgehen ein besseres, richtiges Vorgehen entgegen gestellt und vernünftig begründet werden kann. Rein destruktive Kritik, nach dem Motto: „Was von dieser Regierung kommt, kann nur falsch sein und dient grundsätzlich ganz anderen Zwecken als den vorgegebenen“, mag naive Geister beeindrucken, ist aber nichts anderes, als den Versuchungen der Anarchie nachzugeben. Funktionierende menschliche Gesellschaften sind jedoch ohne Hierarchien, ohne den Verantwortlichen an der Spitze, bisher nicht in Erscheinung getreten. Die Demokratie ermöglicht grundsätzlich den Austausch des Hierarchen – nicht aber, ihn ersatzlos abzuschaffen. Doch das ist ein anderer, weiter Themenkreis. Zu dem ich nur noch einen Gedanken ausführen will:
Wenn es dem Parlament zusteht, für alle denkbaren Lagen Gesetze zu beschließen, dann hatte der Deutsche Bundestag Zeit genug gehabt, sich Gedanken über die Befugnisse der Regierung im Krisen- und Gefahrenfall zu machen. In Bezug auf Corona hätte es nach der ersten Welle – vielleicht unter Verzicht auf die Parlamentsferien – ausreichend Gelegenheit gegeben, unter Bezugnahme auf die Szenarien seriöser Prognosen, den Spielraum der Regierung gesetzlich klar festzulegen. Das ist nicht geschehen.
Jetzt, wo es auf jeden Tag ankommt, noch das Recht des Parlaments einzufordern, ist gleich doppelt beschämend.
- Einerseits, weil das Parlament damit zeigt, dass es die Dinge hat schleifen lassen, dass es nicht im möglichen Maße vorausschauend agiert hat und sich jetzt noch ein Stückchen der Aufmerksamkeit erhaschen will, wohl wissend, dass eine ausreichend fundierte Diskussion der Thematik nicht innerhalb von Stunden geführt werden kann, sondern dass dafür mehrere Wochen veranschlagt werden müssten, mit Expertenanhörungen und schwerwiegenden Gesprächen im Ethikrat, und
- andererseits, weil es die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass ein bezüglich der Einräumung von Sonderrechten der Regierung zu verabschiedendes Gesetz von der Regierung geschrieben, ins Parlament eingebracht und mit der Regierungsmehrheit – zur Not ohne Feststellung der Beschlussfähigkeit – verabschiedet werden würde.
Die Verantwortlichen von Bund und Ländern tun jetzt, was sie jetzt für zwingend erforderlich halten.
Das mag in vielen Details einer sachlichen Kritik nicht standhalten – doch es ist niemand anderes da, der überhaupt eine Entscheidung treffen und verantworten könnte. Ob die teils organisierten, teils nicht organisierten Gruppen von Kritikern über bessere Informationen verfügen und zu klügeren Entscheidungen kommen könnten, für die sie auch die Verantwortung übernehmen würden, und denen nicht wiederum von anderen mit gleicher Intensität Kritik aus der anderen Richtung entgegenschlüge, lässt sich im Strudel der pandemischen Ereignisse nicht feststellen.
Nein, ich bin nicht zum Merkelisten geworden.
Ich sehe lediglich die von der konkreten Situation vollkommen unabhängige Notwendigkeit, dass in kritischen Situationen jemand da sein muss, der – ob mit oder ohne explizite Vollmacht – die notwendigen Entscheidungen trifft und die auch gegen den Widerstand jener durchsetzt, die für ihre Kritik und ihren Widerstand keinerlei Verantwortung tragen oder zu tragen bereit wären.
Die Manöverkritik muss warten, bis sich der Pulverdampf verzogen hat.
Da gibt es dann, im Sommer 2021, sehr viel zu tun.