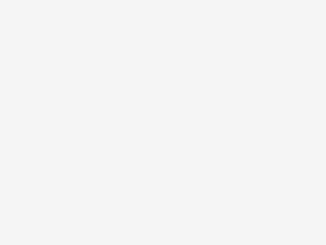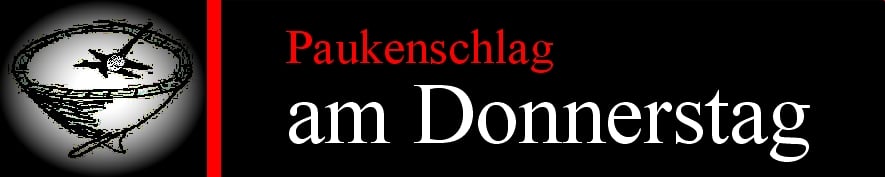
PaD 45 /2022 – Hier auch als PDF verfügbar: Pad 45 2022 Der Streit ums Bürgergeld
Wenn sich Hubertus Heil und Friedrich Merz in der politischen Arena gegenüberstehen und sich um die Ausgestaltung des Bürgergeldes streiten, geht es nicht um das Problem, sondern um seine Vertuschung.
Das Problem besteht doch nicht in der materiellen und ideellen Ausgestaltung von Transferleistungen für Millionen von Menschen in Deutschland, die trotz der von der SPD angestrebten Veränderungen weiterhin als arm, bzw. von Armut bedroht gelten werden. Das Problem ist nicht der Lohnabstand, das Problem ist nicht das Schonvermögen, nicht die Wohnungsgröße und nicht der Heizkostenzuschuss. Es besteht nicht in den Sanktionsmöglichkeiten und Mitwirkungspflichten …
Das ist alles nur Tändelei.
Das Problem besteht darin, dass Millionen von Menschen in Deutschland keine Arbeit angeboten wird, mit der sie ein Einkommen erzielen könnten, das sie materiell deutlich besser stellt als im Leistungsbezug.
Es handelt sich um ein volkswirtschaftliches Problem, das mit Sozialpolitik nicht gelöst werden kann.
Seinen Ursprung findet man in der Produktivitätssteigerung der Wirtschaft, die ja nicht nur den Output gesteigert, sondern mit Automatisierung und Datenverarbeitung auch mehr und mehr Arbeitsplätze überflüssig gemacht hat. Eine Zeitlang wurde dies euphemistisch als der Einstieg in die Dienstleistungsgesellschaft bezeichnet und propagiert. Tatsächlich fanden sich viele der freigestellten Arbeiter und Angestellten irgendwann auch als Beschäftigte im Dienstleistungsbereich wieder, doch der Dienstleistungsbereich – der von den Pflegekräften in Kliniken und Heimen über tausenderlei Berater bis hin zu den Beschäftigten der Logistikbranche reicht, ist alleine nicht überlebensfähig.
Die dort erzielten Umsätze und gezahlten Löhne sind von den Umsätzen und Löhnen der produktiven Wirtschaft abhängig. Es sind die Sozialabgaben der dort Beschäftigten, die so etwas wie eine gesetzliche Krankenversicherung erst möglich machen, aus der wiederum der Medizinbetrieb finanziert wird. Dass die Krankenschwester von ihrem Lohn, der aus den Beiträgen der Produktiven finanziert wird, selbst wiederum Sozialversicherungsbeiträge zahlt, ändert nichts daran. Auch der Steuerberater, der Farb- und Stilberater, der Feng Shui Experte, der Versicherungsberater, der Spielerberater, der Diätberater, die Beschäftigten der Vergleichsportale und die Webdesigner … Alle leben davon, dass die Beschäftigten der Produktion Teile ihres Lohnes ausgeben und die Wirtschaftsunternehmen Teile ihrer Umsatzerlöse verwenden, um sich solche Beratungsleistungen einzukaufen. Das ist die Initialzündung, die erforderlich ist, damit in der zweiten Runde der Steuerberater den Feng Shui Berater anheuern kann, wenn es um die Gestaltung seiner Wohnung oder seiner Kanzlei geht.
Auch die Fahrer der vielen Lieferdienste, die Beschäftigten in den Verteilzentren leben davon, dass die Produktiven bereit sind, nicht nur gegenseitig ihre Produkte zu kaufen, sondern sich diese auch kostenpflichtig nach Hause liefern zu lassen.
Es ähnelt den Problemen beim Wiederanfahren des Stromnetzes:
Ohne schwarzstartfähige Kraftwerke bleibt das Netz tot.
Ohne ausreichende Produktion zerfällt die Volkswirtschaft.
Mitten im Übergang in diese Dienstleistungsgesellschaft erkannten die Vordenker der Globalisierung, dass die vermeintliche Notwendigkeit, auch den Dienstleistern ein Einkommen zu ermöglichen, lediglich dazu führt, dass die Produktion teurer wird als es ohne den ausufernden Dienstleistungsbereich erforderlich wäre. Gerhard Schröder hat sich vor den Karren spannen lassen und alles darangesetzt, um mit der Agenda 2010 die Weichen für die Gestaltung des besten Niedriglohnsektors aller Zeiten zu stellen. Natürlich hat das der Wirtschaft gutgetan und geholfen, den deutschen Export zu immer neuen Rekorden zu treiben. Der Preis dafür war allerdings hoch: Arbeitslosigkeit und Armut wurden für die Wettbewerbsfähigkeit der Exportwirtschaft in Kauf genommen, Vollbeschäftigung und Wohlstand geopfert.
Es kam zu einer Zangenbewegung auf dem Arbeitsmarkt. Frisch Gefeuerte hatten nur noch für sechs Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, danach fielen Sie den JobCentern anheim, mussten erst ihre Ersparnisse aufbrauchen und dann jeden Job annehmen, der ihnen angeboten wurde. Für die Branche der Gebäudereiniger, um nur ein Beispiel zu nennen, ein gefundenes Fressen. Die Personalkosten sanken, weil die ALG2-Leute zu jedem Lohn arbeiten mussten, und daher auch bei „regulären“ Einstellungen – also nicht aus ALG 2 heraus – keine besseren Konditionen mehr angeboten werden brauchten. Die Belastung der Kalkulation der Industrie, sank sowohl durch die mit der Einführung von Hartz IV möglich gewordene Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, als auch durch die damit verbundene Lohndrückerei bei den Beschäftigten solcher Dienstleister. Das Lohnniveau insgesamt wurde von unten her angegriffen und der beabsichtigten Erosion unterworfen, so dass in den letzten 20 Jahren bei der Masse der Beschäftigten ein Kaufkraftverlust zu verzeichnen war. Die Mieten und die Nebenkosten stiegen und auch die Preise für Strom und Benzin verharrten nicht auf dem Niveau des Jahres 2002. Es stellte sich ein schleichender Wohlstandsverlust ein, der durch die Schuldenbremse noch künstlich verstärkt wurde, weil der Staat sich nicht nur selbst verboten hat, mit wirksamen „Konjunkturprogrammen“ dagegen zu steuern, sondern sogar notwendige Ersatzinvestitionen unterlassen, bzw. auf die lange Bank geschoben hat.
Das folgt alles einer perversen Logik, deren Zielrichtung, die Chancen der Exportindustrie zu verbessern, durch staatliche Minderausgaben unterstützt wurde.
Dieser Prozess ist immer noch in vollem Gange. Wer kennt noch die Institution „Postamt“? Das prächtige Gebäude, mitten in der Stadt, mit der langen Schalterreihe, besetzt mit Postbeamten? Wer heute ein Paket aufgeben oder Geld vom Konto bei der Postbank abholen will, steht im Supermarkt in einer Schlange, die sich vom Gemüse zum Leergutautomaten zieht, neben dem sich eine, maximal zwei Personen redlich abmühen, auf engstem Raum, eingekeilt zwischen Transportwagen voller Briefsendungen, Päckchen und Pakete, die Anliegen der Postkunden abzuarbeiten. Was die Post schon hinter sich hat, ist bei den Banken und Sparkassen im vollen Gange. Eine Filiale nach der anderen verschwindet ganz oder wird zur reinen Automatenfiliale umgewandelt.
Es ist auch kaum möglich, den Prozess der Substitution menschlicher Arbeit durch Technik mit allen seinen negativen Folgen wieder umzukehren. Mir jedenfalls fällt keine praktikable Lösung ein, die sich politisch durchsetzen ließe und zugleich wirtschaftlich sinnvoll wäre.
Aber es ist keinesfalls unmöglich, die heute „Überflüssigen“ und gnädig „Durchgefütterten“ aus dem Gefängnis des Nichtstuns und der Abhängigkeit von Sozialtransfers zu befreien.
Man muss den Menschen die Gelegenheit geben, Schritte in die Selbständigkeit zu tun, ohne sie von Anfang an mit Gewerbeanmeldung und Umsatzsteuerpflicht, mit Gewerbeaufsicht und Haftungsfragen in einem Maße zu behelligen, das in krassem Widerspruch zu den kleinen Anfängen steht, mit dem der Mensch versucht mit seinen Kenntnissen und einfachsten Mitteln ein bisschen Geld dazu zu verdienen, was dann auch gleich wieder der Einkommensteuer und der Sozialversicherungspflicht unterworfen wird. Kurz: Alles, was landläufig als Schwarzarbeit gilt, also nicht der organisierte Sozialversicherungsbetrug durch gerissene Sub-Unternehmer mit ihren ausländischen Billigarbeiter-Kolonnen, sollte vollkommen unreglementiert zugelassen werden. Sowohl für die Arbeitslosen im Leistungsbezug, wie auch für alle abhängig Beschäftigten, die nach Feierabend noch nützliche Leistungen auf eigene Rechnung erbringen wollen.
Unmöglich?
Das ist keineswegs unmöglich – und es kostet den Staat noch nicht einmal zusätzlich Geld. Der Staat darf und soll weiterhin für die so genannte Grundsicherung aufkommen. Warum heißt es wohl Grund-Sicherung? Doch nur, weil das Leben erst oberhalb dieser Grundsicherung lebenswert wird.
Es kostet den Staat nicht nur kein zusätzliches Geld, es bringt ihm – im Gegenteil – sogar mehr Geld ein. Ich werde das noch erläutern.
Aber von Anfang an:
Die Klage der Hartz-IV-Bezieher, ihnen stünde schon für den nackten Lebensunterhalt zu wenig Geld zur Verfügung, von einer wirklichen, soziokulturellen Teilhabe ganz zu schweigen, ist doch vollkommen berechtigt. Der so genannte Regelsatz reicht, auch bei einem sehr geringen Anspruchsniveau, vorne und hinten nicht.
Die Klagen der Kassenwarte in Bund und Ländern, es stünde einfach nicht genug Geld zur Verfügung, um 5,4 Millionen Leistungsberechtigten nach SGB II (Stand Oktober 2022) die von den Sozialverbänden geforderte Aufstockung um 200 Euro monatlich zukommen zu lassen, ist ebenfalls berechtigt. Schließlich kämen da pro Jahr rund 13 Milliarden Euro zusammen, bereinigt um den Rückfluss aus der Mehrwertsteuer immer noch mindestens 10 Milliarden, die man nicht so einfach aus dem Hut zaubern kann.
Die Klagen der Wirtschaft, die eher nur hinter vorgehaltener Hand geäußert werden, dass nämlich eine derartige Erhöhung der Regelleistung sehr schnell auf das gesamte Lohngefüge von 40 Millionen Beschäftigten durchschlagen und Mehrkosten von 70 bis 80 Milliarden auslösen würde, sind zumindest korrekt begründet, ob sie in jedem Fall ihre Berechtigung durch den Anspruch auf den gewohnten Gewinn erlangen, mag dahingestellt bleiben.
Es sind hier drei Stricke zu einem gordischen Knoten verknüpft, die ein Gefühl der Aussichtslosigkeit vermitteln. Das gilt nicht nur für die Frage der Anhebung der Regelsätze, es gilt viel mehr für die Frage, wie das produktive Potential von immerhin 3,8 Millionen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern für die Volkswirtschaft erschlossen werden könnte. Das ist doch das eingangs bereits benannte Grundproblem.
Mit den bestehenden Hinzuverdienstgrenzen kann das Problem nicht gelöst werden. Damit verliert die Arbeitsaufnahme von Leistungsbeziehern jeglichen Anreiz, wird der mögliche Hinzuverdienst doch mit massiven Abschlägen bei der Grundsicherung bestraft. Nehmen wir einen Mini-Jobber mit dem Mindestlohn von 12 Euro und monatlich 37,5 Arbeitsstunden, was einen Mini-Job-Lohn von 450 Euro ergibt, so führt das zu einer Kürzung der Regelbezüge um 280 Euro. Der Minijobber verdient in diesen 37,5 Stunden also nicht 450 Euro, sondern nur 170 Euro. Sein Stundenlohn schrumpft auf mickrige 4,53 Euro zusammen und entspricht damit längst nicht mehr dem Mindestlohn, unterhalb dessen kein Arbeitnehmer beschäftigt werden darf. Ein starker Anreiz dafür, entweder ein Arbeitsverhältnis einzugehen oder ein eigenes kleines Geschäft auf die Beine stellen zu wollen, ist das nun wirklich nicht.
Den gleichen demotivierenden Effekt kennen wir übrigens auch aus höheren und höchsten Einkommensgruppen, es lohne sich eigentlich nicht, sich noch mehr anzustrengen, wo sich der Fiskus doch sowieso den Löwenanteil davon holen wird, heißt es da oft und oft. Diese Argumentation wird allerdings zumeist zustimmend akzeptiert, und wenn die Wirtschaftsweisen empfehlen, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, springt der Finanzminister wie das Teufelchen aus der Kiste und verweigert auch den geringsten Kompromiss.
Welche Veränderungen, und welche neuen Probleme wären mit der Legalisierung der Schwarzarbeit verbunden?
Lassen wir den Hartz-IV-Empfänger im Gedankenexperiment so viel hinzuverdienen, wie es ihm möglich ist. Um wieviel erhöhen sich die Ausgaben des Staates für seine Grundsicherung, wenn er monatlich a) 500 Euro, b) 1.000 Euro, c) 10.000 Euro dazuverdient?
Na? Richtig: Die Ausgaben des Staates erhöhen sich durch den Hinzuverdienst des Leistungsempfängers um keinen Cent.
Es ist wie mit den Windrädern. Ob da 500 oder 1.000 oder 10.000 bei Flaute stillstehen, an der erzeugten elektrischen Leistung ändert sich nichts. Die bleibt bei null stehen.
„Ungerecht, Ungerecht!“, höre ich da empörte Sozialpolitiker (ja, Sozialpolitiker) rufen. „Wie kann man denn jemandem, der schon selbst 10.000 Euro im Monat verdient, immer noch Sozialleistungen hinterher werfen?“
Das ist nicht ganz unberechtigt. Doch wenn einige aus dem Kreis der Sozialpolitiker ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen wollen, das tatsächlich zum gleichen Gerechtigkeitsproblem führen würde, dann sollten denen auch ihre Argumente wieder einfallen, warum dies keineswegs ungerecht sei.
Spaß beiseite. Nicht die Sozialpolitiker, die in der Regel finanziell bestens versorgt sind, haben Grund, sich über die Ungerechtigkeit aufzuregen, sondern die abhängig Beschäftigten, zumal die sich darauf berufen können, diese ungerechtfertigten Zahlungen wiederum mit ihren Steuern finanzieren zu müssen. Dazu später noch mehr.
Es gilt vorher allerdings noch einen zweiten, eher unsichbaren Aspekt zu betrachten, der den Ungerechtigkeits-Effekt wieder relativiert. Die von allen Einschränkungen befreite, und daher zunehmende „Schwarzarbeit“ erhöht die volkswirtschaftliche Gesamtleistung, das BIP. Es vollzieht sich ein Wachstum. Dessen Umfang ist schwer abschätzbar, daher setze ich hier die folgenden, vollkommen willkürlichen Annahmen:
Von 3,8 Millionen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern wird vielleicht ein Fünftel tatsächlich in der Lage sein, durchschnittlich 1.000 Euro monatlichen Hinzuverdienst zu generieren. Zehn Prozent mögen es hin und wieder probieren, aber damit keinen Erfolg haben, und 70 Prozent haben keine Idee für eine lohnende Betätigung. Das Ergebnis schlägt sich im BIP mit knapp 10 Milliarden Euro nieder.
Das ist aber noch nicht alles. Die „Schwarzarbeiter“ werden ihren Hinzuverdienst nämlich höchstwahrscheinlich nicht in ihre Sparstrümpfe stecken, sondern froh sein, sich endlich wieder Dinge leisten zu können, auf die sie bisher verzichten mussten. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Geld zu annähernd 100 Prozent sehr zeitnah wieder ausgegeben wird. Der allergrößte Teil wird dabei in die reguläre Wirtschaft fließen und dort ebenfalls ein Wachstum um 10 Milliarden Euro auslösen. Dieses Wachstum ist arbeitsmarktwirksam. Es werden davon in Deutschland etwa 100.000 Arbeitsplätze geschaffen oder nicht vernichtet werden. Diese 100.000 Arbeitsplätze holen 100.000 Menschen aus dem Leistungsbezug. Der Staat spart sich dadurch, dass er für 760.000 Schwarzarbeiter die Regelleistung weiter bezahlt (rund 1.000 Euro pro Monat incl. Miete und Heizkosten), die er sowieso hätte weiter bezahlen müssen, jährlich etwa 1,2 Milliarden an Sozialleistungen – und er bekommt alleine über die Mehrwertsteuer dieser neu Beschäftigten und der Schwarzarbeiter, die ja auch beim Einkauf MwSt. zu zahlen haben, weitere 3 Milliarden in die Kasse.
Nun mag man meine willkürlichen Annahmen anzweifeln oder gar bestreiten, auf die tatsächlichen Größenordnungen kommt es nicht an. Es geht hier einzig darum das Prinzip zu veranschaulichen, das grundsätzlich gültig ist, nämlich dass jede zusätzliche Produktion, sofern sie Abnehmer findet, den Wohlstand einer Volkswirtschaft mehrt. Auch, und gerade dann, wenn es sich um ein Ergebnis der Schwarzarbeit handelt, weil der Schwarzarbeiter seine Leistung einfach deutlich günstiger anbieten kann und damit ein Bedarf, der wegen der fehlenden Kaufkraft sonst nicht zur Nachfrage würde, befriedigt werden kann.
Damit ist das Argument der staatlich registrierten Betriebe, die Schwarzarbeiter würden ihnen das Geschäft ruinieren, zumindest zur Hälfte entkräftet. Wer in seinem Budget jährlich 100 Euro für den Friseurbesuch zur Verfügung hat, wäre vielleicht drei Mal im Jahr für 30 Euro zum Friseur gegangen, kann sich für 10 Euro bei der mobilen Schwarzsarbeitsfrisöse aber zehn Mal die Haare schneiden lassen.
Das Argument, die Schwarzarbeiter würden mindere Qualität abliefern, ist beim Friseurbeispiel auch leicht zu entkräften. Wer mit seiner Schwarzarbeiterfrisur total unzufrieden ist, wird seine Haare wieder länger wachsen lassen und zum Friseurmeister zurückkehren, aber eben auch nicht öfter als vorher.
Es gibt natürlich auch Tätigkeiten bei denen es auf Fachwissen und die Einhaltung technischer Vorschriften ankommt. Weil von fehlerhaften Ausführungen erhebliche Gefahren ausgehen können. Das bringt im Zusammenhang mit dem Schwarzarbeiter ein Haftungsproblem hervor. Zum Beispiel die einfache Vorschrift, dass ein Elektroherd mit seiner 3-Phasen-Zuleitung nur von einem Meister-Fachbetrieb angeschlossen werden darf. Wird dieser in Anspruch genommen, haftet heute der Meister für den Pfusch seines Mitarbeiters, den er fraglos ungenügend angeleitet und überwacht hat. Dennoch handelt es sich dabei um keine Hexerei. Wer eine Ausbildung zum Elektriker absolviert hat, oder sich das notwendige Wissen auf andere Weise aneignen konnte, wird das genauso zuverlässig erledigen, wie wenn er im Fachbetrieb angestellt wäre. Worauf es ankommt, das ist tatsächlich die Klärung der Haftungsfrage. Beim Schwarzarbeiter wird in der Regel wenig zu holen sein. Also bleibt der Kunde auf seinem – und ggfs. darüber hinausgehenden Schaden – haftend sitzen, genau so, wie es heute auch schon ist, nur dass dem Kunden und dem Schwarzarbeiter noch zusätzliche Strafen wegen Verstoß gegen diverse Vorschriften drohen.
Nun gehört das Einfamilienhaus, das wegen einer fehlerhaften Elektroinstallation halb abgebrannt ist, aber nicht dem Staat. Der Staat hat auch keinen Schaden erlitten. Warum erdreistet er sich, über den Schaden hinaus auch noch Bestrafung zu fordern? Es ist diese Denkweise, die dem Staat alle Verantwortung zuweist, als wäre er die Mutter und die Staatsangehörigen nur unmündige Kinder, denen man mit engen Vorschriften und strengen Strafen das Überleben sichern muss. Solche strafbewehrten Vorschriften stehen in einer Reihe mit Maskenzwang, Lockdown und Impfnötigung.
In einer Marktwirtschaft erwirbt ein Wettweber die „Lizenz“ zum Anschluss von Elektroherden und wirbt damit, in der Haftung zu stehen, während ein andere diese Lizenz nicht erwirbt, was dem Kunden eindeutig signalisiert, dass er auf einem eventuellen Schaden sitzen bleiben wird. Punkt. Aus. Es sollte einzig in der Verantwortung des Kunden stehen, welchen von beiden er beauftragt, und das wiederum wird mit dessen eigener Sachkunde zusammenhängen. Wer vom Strom nicht mehr weiß, als dass er halt aus der Steckdose kommt, wird eher auf Nummer sicher gehen.
Welchen Einfluss wird nun eine vermehrte „Schwarzarbeit“ auf die Betriebe der „regulären“ Wirtschaft haben, wie sieht also die andere, noch nicht entkräftet Hälfte des Arguments aus, die Schwarzarbeiter würden das Geschäft ruinieren?
Bleiben wir beim Handwerk, nehmen wir den Heizungs-, Gas- und Wasser-Installateur. Wie in vielen mit dem Bau verbundenen Gewerken unterscheidet sich das Geschäft in zwei Zweige. Den Bereich der Neuinstallation und den von Wartung, Instandsetzung, Reparatur und Austausch. Neuinstallation ist schön. Es gibt aktuelle Pläne, man hat die Baustelle für sich und kann den zumeist großen Auftrag zügig und planmäßig abarbeiten. Der andere Bereich ist weniger schön. Es gibt keine oder nicht mehr zutreffende Pläne, die Baustelle ist schwer zugänglich, der Auftraggeber steht dabei und stellt dumme Fragen oder gibt noch dümmere Ratschläge. Der Auftrag ist überschaubar klein, vom Zeitaufwand nur schwer zu planen, und auch wenn die Gewinnspanne höher ist als beim Neubau, wo man vor dem Architekten die Hosen herunterlassen muss, um den Zuschlag zu bekommen: In absoluten Zahlen bleibt nicht viel hängen. Folglich bekommt der Kunde, der verzweifelt anruft, weil die Heizung spinnt, zwar den nächstmöglichen Termin, der aber dennoch frühestens in der nächsten Woche zu finden ist und der dann nicht selten noch nicht einmal eingehalten werden kann.
Der Schwarzarbeiter, der sich mit Heizungen auskennt, hat normalerweise kein Neubaugeschäft, das durch diesen Auftrag gestört würde, er hat normalerweise auch keinen Terminkalender, der so voll ist, dass er nicht unmittelbar oder doch spätestens am nächsten Tag bei der Problemheizung auftauchen könnte. Er ruiniert also den regulär arbeitenden Installateur nicht, er entlastet ihn.
Ja, aber!
Richtig. Alles zulassen, trotzdem Regelleistungen erbringen, das wird dann ja doch ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil nur die wenigsten einen so qualifizierten Job ausüben, dass es sich für sie lohnt, an 230 Tagen im Jahr an der Arbeitsstelle zu erscheinen. Außerdem gerät die Staatsfinanzierung aus den Fugen. Eine rote Linie muss her, bei deren Überschreiten der Spaß für den legalen Schwarzarbeiter aufhört.
Weil das Gewerbe nirgends offiziell angemeldet ist, auch nicht beim Finanzamt, folglich dem Staat keine Informationen über den Geschäftsumfang vorliegen, muss diese rote Linie so gestaltet sein, dass sie vom erfolgreichen Schwarzarbeiter von alleine überschritten wird und einen Meilenstein in seiner Geschäftsentwicklung darstellt, auf den er auch stolz ist, statt sich nur darüber zu ärgern. Ich sehe da zwei mögliche rote Linien, die mühelos und ohne bürokratischen Aufwand gezogen werden können.
Der nur im direkten Geschäft mit mehreren, wechselnden Endkunden tätige Schwarzarbeiter, wird keine dieser beiden roten Linien je überschreiten. Ob Zugehfrau oder Maler, Kfz-Schrauber oder Nebenwerbsfriseuse, sie alle verdienen alleine an ihrer Arbeitskraft und die tragen sie recht billig zu Markte, während ihre Auslastung nur selten einer echten Vierzig-Stunden-Woche nahekomen dürfte. Sie haben zudem Kunden, die keinen Wert darauf legen, dass sie eine Rechnung erhalten, auf der noch dazu die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, und sie brauchen keinen Laden, kein Büro keine Werkstatt – das häusliche Wohnzimmer, der Pkw oder der Lieferwagen sind vollständig ausreichend.
Wo ein Geschäft größer wird, wo ein Schwarzarbeiter Aufträge von Unternehmen ausführt, ändert sich beides. Der Kunde will eine ordentliche Rechnung, weil er seine Kosten gegenüber dem Finanzamt nachweisen muss, und weil er in seiner Umsatzsteuererklärung gerne die vom ihm gezahlte Vorsteuer ausweisen will, was den von ihm abzuführenden Umsatzsteuerbetrag reduziert. Der Schwarzarbeiter schreibt aber keine Rechnung, die vom Finanzamt anerkannt würde, und er weist keine Umsatzsteuer aus, obwohl in seinem Umsatz – vor allem wenn er für seine Tätigkeit viel Material, Werkzeuge, usw. benötigt – durchaus bereits von ihm gezahlte Umsatzsteuer erhalten ist, die ihm aber auch niemand erstattet, weshalb er sie an seine Kunden, ohne sie auszuweisen, weitergeben muss. Auf diese Weise kann seine Leistung gegenüber Geschäftskunden alleine aus steuerlichen Gründen trotz günstigem Preis uninteressant werden. Will er sich dieses Marktsegment erschließen, weil er sich gute Umsätze und Gewinne erwartet, dann ist der Schritt zur Gewerbeanmeldung bei Kommune und Finanzamt unumgänglich. Hat er bereits Mitarbeiter beschäftigt, muss er mit diesen reguläre Arbeitsverhältnisse eingehen und künftig Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge abführen. Sieht er in all diesen zusätzlichen Anforderungen kein Hindernis für künftig gute Geschäfte, dann wird aus dem Schwarzarbeiter ein Unternehmer. Wobei ich mir hier auch noch eine Übergangsphase von zwei bis drei Jahren vorstellen kann, in denen die bürokratischen und steuerlichen Lasten auf ein Minimum gesenkt bleiben.
Die zweite rote Linie findet sich da, wo ein Geschäft so umfangreich geworden ist, dass es von Wohnzimmer und Lieferwagen aus nicht mehr beherrscht werden kann. Wer Büroräume, ein Ladenlokal, eine Werkstatt anmietet, pachtet oder kauft, soll die entsprechenden Verträge nur abschließen können, wenn spätestens gleichzeitig die Gewerbeanmeldung erfolgt. Dies wird eine gesetzliche Verpflichtung für Vermieter und Makler erfordern, die einfach so gelöst werden kann, dass der Gesetzgeber festlegt, dass ein Gewerbemietvertrag, der nicht mit ordentlich registrierten Gewerbetreibenden, Selbständigen oder Unternehmen abgeschlossen wurde, als von vornherein nichtig anzusehen ist.
In beiden Fällen wandert dann auch die Haftung für eventuelle Schäden vom Kunden des Schwarzarbeiters zum nun verantwortlichen Unternehmer.
Mit der Errichtung dieser beiden roten Linien wird es den Schwarzarbeiter mit monatlich unversteuerten Einnahmen von 10.000 Euro oder mehr, der noch dazu Grundsicherung bezieht, kaum noch geben können.
Abschließend noch ein Blick auf die Tatsache, dass die regulär arbeitenden Unternehmen und deren Beschäftigte mit ihren Steuern und Abgaben die Finanzierung der Grundsicherung für ihre schwarz arbeitende Konkurrenz aufbringen müssen.
Dass in diesem Vorschlag vorgesehen ist, dass der einzelne Schwarzarbeiter, wenn sich sein Geschäft ausweitet, auf die eine oder andere Weise gezwungen sein wird, ein ordentliches Unternehmen zu gründen, ändert ja nichts daran, dass allein die schiere Masse der in einer Branche tätigen Schwarzarbeiter die Umsätze der regulären Unternehmen massiv schädigen könnte.
Dies wird am Frisör-Beispiel ganz besonders deutlich sichtbar. Eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, die sich durchschnittlich alle sechs Wochen die Haare schneiden, waschen, föhnen, färben lassen, braucht ungefähr 500 Frisösen und Frisöre in insgesamt 25 bis 35 Salons.
(100.000 Ew mit je 1 Stunde Behandlungszeit innerhalb von 6 Wochen á 5 Tage zu 8 Stunden, ergibt unter Berücksichtigung von Urlaub, Krankheit und Berufsschultagen den Bedarf von 500 Frisören.)
Diese Zahl wird in wohlhabenden Kommunen erreicht, ggfs. sogar überschritten, in anderen Kommunen ist die Frisördichte geringer, weil die Einkommensstruktur der Einwohner ihren Schwerpunkt an der Armutsgrenze ausgebildet hat. Entsprechend sehen die Leute, denen man auf der Straße begegnet, frisurtechnisch auch aus. In den wohlhabenden Kommunen wird sich am Umsatz der stationär betriebenen Salons wenig ändern. Die Kundschaft kann das Geld für den Frisörbesuch erübrigen und genießt das entspannte Ambiente, die Tasse Kaffee und die charmante Behandlung und zahlt dafür gerne Beträge von 30 Euro aufwärts. Wir sehen einen Markt, in dem Angebot und Nachfrage sich auf diesen Preis geeinigt haben. Die Chancen für schwarz arbeitende Frisöre sind gering, außerdem haben fast alle ausgelernten Frisöre einen Job als Frisör gefunden.
In der armen Stadt sieht das anders aus. Hier werden schwarz arbeitende Frisöre zur echten Konkurrenz, weil sie ihre Arbeit – jetzt ohne Angst erwischt und bestraft zu werden – auch auf Menschen außerhalb des Freundes und Bekanntenkreises ausdehnen können. Was dazu führt, dass Kunden, die früher nur alle drei bis vier Monate zum Kahlschlag im Salon angetreten sind, jetzt gänzlich fernbleiben, während sich das Straßenbild – frisurtechnisch – erfreulich verändert. Ist dieser Zustand eingetreten, finden wir auch hier einen Markt vor, in dem sich Angebot und Nachfrage mit einem Zuwachs an Wohlstand ausgeglichen haben, obwohl die Zahl der stationären Frisörsalons gesunken ist.
Das wichtigste Argument, dass sinnvolle Beschäftigung möglichst vieler Mitglieder einer Gesellschaft den Wohlstand erhöht – ohne dass der Staat dafür Mehrausgaben zu bewältigen hätte, zeigt sich hier in seiner ganz konkreten Ausprägung. Die Ursache ist eine Umverteilung von oben nach unten, die möglich wird, weil die Preise für die Leistungserbringung so weit gesunken sind, dass sie von den Wohlhabenderen akzeptiert werden.
Das zeigt sich eben nicht nur beim Frisör, sondern auch bei der Putzhilfe, der Zugehfrau. Die muss, um über die Runden zu kommen, bei angemeldeter Tätigkeit, mindestens 15 Euro pro Stunde nehmen, aber zugleich aufpassen, dass ihre Einnahmen nicht die Verdienstgrenzen der Mini- oder Midi-Jobber übersteigen. Das ergibt für einen Haushalt, bei zwei Terminen pro Woche mit je drei bis vier Stunden, einen monatlichen Ausgabenposten von etwa 450 Euro. Das wiederum können und wollen sich nur wenige leisten. Bei Kosten von 200 Euro pro Monat vervielfacht sich die Zahl derjenigen, die eine solche Leistung in Anspruch nehmen, also ergibt sich eine Umverteilung von oben nach unten, die sonst nicht stattgefunden hätte. Nimmt man an, dass von 100 Haushalten nur einer bereit ist, 450 Euro für die Putzhilfe auszugeben, während weitere zwei von hundert sich auf 200 Euro einlassen würden, dann ergäbe das bei 40 Millionen deutschen Haushalten theoretisch ein Beschäftigungsvolumen für bis zu 150.000 Vollzeit-Putzhilfen, mit einem Monatseinkommen von durchschnittlich 1.000 Euro pro Monat.
Weil ziemlich sicher ist, dass diese Einkommen sofort in den Konsum fließen, entsteht so – im Detail erkennbar – der bereits pauschal beschriebene Wachstumseffekt, wiederum, ohne dass der Staat dafür mehr aufwenden müsste, nur durch das per Deregulierung ermöglichte Mehr an sinnvoller Beschäftigung, die zu Preisen angeboten wird, die von der Nachfrageseite akzeptiert werden.
Nun zum definitiven Aha-Erlebnis in diesem Paukenschlag:
Die Nachfrageseite akzeptiert heute, mit maßvollem Murren, dass sie die Grundsicherung über Steuern und Abgaben finanzieren muss, ohne dafür eine Leistung zu erhalten. Sie akzeptiert zudem die Preise der legalen Schwarzarbeiter – und erhält dafür eine Leistung, für die sie „regulär“ungefähr das Doppelte aufzuwenden hätte.
Während über die staatlichen Transferleistungen sichergestellt wird, dass jeder Bedürftige zumindest seine Grundbedürfnisse befriedigen kann, wird die Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leistungsempfänger gestärkt und jeder Versuch, die eigene Situation auf legalem Wege zu verbessern, belohnt, ohne dass eine den Neidgedanken unterstützende Bürokratie die Motivation mit unsäglichen Hinzuverdienstgrenzen wieder zunichte macht.
Das Ei des Kolumbus? Die Quadratur des Kreises?
Sicherlich nicht.
Aber sehr wohl eine Überlegung, die weit über den kleinlichen Streit um Schonvermögensgrenzen und den Härtegrad von Sanktionen hinausweist.
Sollten Sie mit Ihrem Plan sich selbständig zu machen, nicht warten wollen, bis der Einstieg einfacher wird, wenn die Schwarzarbeit legalisiert ist, oder jemanden kennen, der vor dieser Entscheidung steht, kann ich Ihnen nur Mut zusprechen.
Es funktioniert auch unter den herrschenden Bedingungen – und gerade die heraufziehende Krise bietet viele Chancen mit neuartigen Geschäftsideen an den Start zu gehen. Worauf Sie in Bezug auf alle bürokratischen Anforderungen achten müssen, das erfahren sie in den Gründungsbroschüren von IHK und Handwerkskammer.
Was Sie dort eher nicht erfahren, nämlich wie sich die Selbständigkeit in der Praxis gestaltet, das habe ich – für Sie, aber auch für Ihre künftigen Wettbewerber – in diesem Buch zusammengefasst.

Klug ist, wer sich vorher schlau macht.
Hier zu haben.