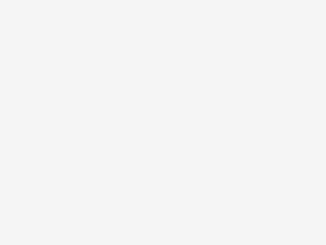PaD 2 /2022 vom 13.01.2022
Teil und 1 und 2 sind hier in einem PDF-Dokument zusammengefasst:PaD 1 und 2 2022 Wachstum und Nachhaltigkeit
Der erste Teil dieses Aufsatzes endete mit diesen Aussagen:
Der Wachstumspfad der Ökonomen beginnt bei Not, Armut und Arbeitslosigkeit, bringt allmählich Beschäftigung und Wohlstand und eine steigende Zahl von Unternehmen hervor, die zur Mehrung des Wohlstands beitragen. Der Wettbewerb sorgt gleichzeitig dafür, dass Unternehmen aus dem Markt verdrängt werden. Ab dem Zeitpunkt, ab dem mehr Unternehmen verschwinden als neu dazu kommen, wenn sich also ein Konzentrationsprozess abzeichnet, sinken Beschäftigung und Wohlstand wieder, bis – im schlimmsten Fall – ein weltbeherrschender Monopolist an seiner Sinnlosigkeit zusammenbrechen wird, wobei er durchaus weite Teile der Menschheit schon in der letzten Phase seines Aufstiegs (mit) in den Untergang reißen wird.
So weit ist es allerdings noch nie gekommen. Konzentrationsprozesse endeten stets vor dem Erreichen der „Weltherrschaft“. Zum Teil deshalb, weil ihr weiterer Aufstieg von anderen Mächten verhindert wurde, zum Teil jedoch auch deshalb, weil sie eine nicht mehr beherrschbare Größe überschritten hatten und unter inneren Machtkämpfen auseinander fielen.
Der Verzichtspfad der Ökologen beginnt im Paradies, wo Adam und Eva in vollkommener Harmonie mit allen Pflanzen und Tieren ein sorgenfreies Leben führen. Von da an wächst die Zahl der Menschen und damit beginnt die Not-wendigkeit für das tägliche Brot zu arbeiten.
Glücklicherweise war die Zahl der Ökologen auch in den ersten Jahrtausenden nach der Vertreibung aus dem Paradies noch sehr überschaubar, so dass die vorstehende Aussage zum Beginn des Verzichtspfades der Ökologen rein spe-kulativer Natur ist. Realistisch betrachtet hat er tatsächlich erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen – und dies auch nur in eng begrenzten Welt-gegenden. Die erste laut vernehmliche Äußerung der Ökologen kam vom Club of Rome, dessen Mitglieder 1968 zusammenfanden und 1972 mit ihrem Werk „Die Grenzen des Wachstums“ ihren ersten und lautesten Paukenschlag erklin-gen ließen. Angemerkt werden muss, dass nur zwei Jahre vorher Karl Stein-buchs Bestseller „Programm 2000“ erschienen war, dessen Technik- und Fort-schrittsgläubigkeit in einen vehementen Aufruf zu einer Bildungsreform mün-dete, was der SPIEGEL seinerzeit ziemlich kritisch so beschrieben hat:
„Für Steinbuch liegt die Wahrheit im Computer — wenn überhaupt irgendwo; das Apollo-Programm ist ihm Modell für die Lösung sozialer Probleme; die Probleme der Dritten Welt, meint er, können technisch gelöst werden; aus einer Datenbank sollen wir Informationen beziehen, wie gesellschaftliche Veränderungen am besten zu organisieren wären; das rationale Denken der Naturwissenschaften soll die Scholastik der Second-Hand-Propheten (das sind die Philosophen) überwinden. Die Lenkung der Gesellschaft ist ein technisches Problem, das dann gut gelöst werden kann, wenn wir nur genügend viele »Institute« mit den »besten Köpfen« des Landes einrichten. Dort kann dann auch eine »Friedensstrategie für den sozialen Bereich« entwickelt werden, die von den gesellschaftlichen Individuen schon akzeptiert werden wird, wenn sie durch ihre naturwissenschaftliche Ausbildung erst einmal befähigt sind. »rationale« Lösungen zu akzeptieren. Naturwissenschaftliches und technisches Denken ist für Steinbuch per se progressiv.“
Mit dem Auftauchen der Grünen auf der politischen Bühne, zunächst noch als „Außerparlamentarische Opposition“ (APO), entwendeten die Anhänger der Verzichts- und Verbotslehre den Fortschrittsgläubigen, wie Steinbuch, das Prädikat „progressiv“ und hefteten es ihrer auf Rückschritte gerichteten Agenda an. Wobei die ersten Rückschritte durchaus Erstaunliches zuwege brachten.
Fische und Muscheln kehrten in stehende und Fließgewässer zurück, weil die Wasserqualität mit Hilfe massenhaft errichteter Kläranlangen verbessert werden konnte. Rauchgasentschwefelung und schwefelarme Kraftstoffe verminderten den Sauren Regen, unter dem die Wälder litten. Ruß- und Feinstaubfilter verbesserten die Atemluft. Die Renaturierung von Auenlandschaften, Kiesgruben und Tagebauen hielt das Artensterben auf. Deutschland ist grüner geworden, was allerdings kaum möglich gewesen wäre, hätten nicht Union und SPD grüne Ziele und Absichten übernommen und, bemüht, verlorene Wählerstimmen zurückzuholen, vor allem das Kapital und über das Kapital die Unternehmensvorstände zum Mitmachen bewegt.
Letzteres war nicht so schwer, denn Gewinne, die durch teure Umweltschutzauflagen verloren gingen, konnten mit den Gewinnen aus den neuen, grünen Tätigkeitsfeldern zumindest kompensiert werden.
Ansonsten ist es mit den Grünen so, wie mit der Schaumweinsteuer. Die wurde von Wilhelm II. zweckbestimmt zur Finanzierung der Kriegsflotte des Kaiserreiches eingeführt und wird seitdem ununterbrochen erhoben, obwohl die kaiserliche Flotte längst nicht mehr existiert. Auf die gleiche Weise sind uns auch die Grünen, nachdem die eigentliche Arbeit getan war, und die bestand darin, ein gesamtgesellschaftliches Umweltbewusstsein zu schaffen, erhalten geblieben.
Bestand der Erfolg ihres Wirkens bis dahin darin, einen starken Beschäftigungsimpuls zu setzen, der sich in der Reduzierung der Umweltbelastung mit echten Schadstoffen niederschlug und bedrohten Tier- und Pflanzenarten geschützte Habitate zuwies, wandelten sich danach ihre Grundeinstellungen. Aus dem Willen zur Verbesserung der Verhältnisse entwickelte sich eine Art Sucht, ständig Missstände und Probleme suchen zu müssen und diese in den düstersten Farben an die Wand zu malen, weil der Gedanke, nach getaner Arbeit, mit keinem anderen Thema mehr, als dem nicht zu gewinnen scheinenden Kampf gegen die Kernkraftwerke, im Grunde überflüssig geworden zu sein, schlicht und einfach unerträglich war.
Es kamen, in rascher Folge das Eintreten für den Feminismus, den Genderismus und die Willkommenskultur hinzu, womit sich der übergeordnete Gedanke des Teilens als Aspekt einer globalen Gerechtigkeit auch auf die unterschiedlichen ökologischen Fußabdrücke bezog und die ursprüngliche Phase der Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedingungen in den Hintergrund trat.
Stattdessen gelangte man zu dem Schluss: „Weil schon mehr als genug Wachstum stattgefunden hat, muss das Wachstum gebremst, am besten in einen Schrumpfungsprozess überführt werden, und das, was dann noch verfügbar bleibt, ist unter allen Menschen möglichst gerecht, also in gleichen Anteilen zu verteilen.“
Kein Wunder, dass die Theorie einer bevorstehenden Klimakatastrophe begeistert aufgenommen wurde. Ein Kampf gegen den Klimawandel, der sich leicht in einen Kampf gegen den Einsatz einer leicht zugänglichen und preiswerten Energie umgestalten ließe, würde sämtliche Wachstumsimpulse ersticken und müsste früher oder später dahin führen, dass der Ressourcenverzehr der Menschheit, vor allem in den hochentwickelten Staaten, durch drastische Verbote und abschreckende Besteuerung des Energieverbrauchs, für die gesamte Erde auf jenes Maß zurückgeschraubt werden kann, der eine nachhaltige Be-wirtschaftung des Planeten möglich macht.
Es nicht ganz auszuschließen, dass es unter den Anhängern dieser Philosophie trotzdem noch einzelne Nachdenkliche gab, die über ein praktisches mathematisches Verständnis verfügten und feststellten, dass der Rückbau der Industrie, die Umstellung der industrialisierten Landwirtschaft auf Ackerbaumethoden des 19. Jahrhunderts und die Abschaffung der Nutztierhaltung zwar allesamt der Herstellung eines romantisch verklärten Idealbildes des Lebens im Einklang mit der Natur dienten, aber eben auch den zur Verteilung bereitstehenden Kuchen extrem verkleinern würden, während die Gleichverteilung der noch erlaubten Produktion auf eine immer noch weitere wachsende Weltbevölkerung eher nach „mehr“ verlangen würde.
Die Lösung heißt, wie im ersten Teil dieses Aufsatzes bereits angesprochen wurde: Verzicht.
Verzicht auf individuelle Mobilität, Verzicht auf das Wohnen im Einfamilienhaus, Verzicht auf Fleischverzehr, Verzicht auf Flugreisen, Verzicht auf eine zuverlässige und sichere Stromversorgung und so weiter. Vor allem aber der Verzicht auf die Rückkehr zum Wachstumspfad der Ökonomen, was am krassesten da zu Tage tritt, wo selbst noch der Verzicht auf Kinder propagiert wird, weil dieser Verzicht in ganz erheblichem Umfang dazu beitrage, die CO2-Emissionen zu Verringern.
Zum Lösungsansatz gehört aber auch die gutgläubige Annahme, wenn erst einmal der Wettbewerb der Ökonomen beendet sei, der als Quelle des unerwünschten Wachstums verboten werden muss, und die knappen Güter gerecht und gleich an alle verteilt würden, am besten über ein globales, bedingungsloses Grundeinkommen, werde auch der Wettbewerb der Individuen um die knappen Güter aufhören.
Dass das Wachstum und der Wettbewerb der Ökonomen in einen massiven Konzentrationsprozess münden, weil jene, die nicht mithalten können, vom Wettbewerb ausgeschlossen werden und in Armut fallen, wurde bereits angesprochen. Dass dieser Konzentrationsprozess zu Oligopolen und Monopolen führt, die schließlich die Lebensverhältnisse auf der ganzen Welt bestimmen, bis sie, mangels Kaufkraft der Konsumenten in sich zusammenbrechen, wurde ebenfalls bereits erwähnt.
Wohin aber führt der Kurs der Ökologen?
Für deren Kurs gibt es, abgesehen von kleinen, eng begrenzten Experimenten, keine historischen Vorbilder, aus denen man etwas Ähnliches wie die zyklischen Zusammenbrüche des Systems der Ökonomen ableiten könnte. Wenn überhaupt eine Analogie aufzufinden ist, dann in den auf Sklaverei aufgebauten Wirtschaftssystemen.
Sklavenhalter haben schnell herausgefunden, mit welch geringem Aufwand an Nahrung, Kleidung und Behausung die Arbeitskraft über den wirtschaftlich sinnvollen Nutzungszeitraum erhalten werden kann. Sie haben auch herausgefunden, dass maximaler Freiheitsentzug, verbunden mit strengsten Verboten, höchsten Arbeitsnormen und drakonischen Strafen erforderlich ist, um die Arbeitsleistung der Sklaven tatsächlich abrufen zu können, weil diese sonst nämlich keinen Sinn darin gesehen hätten, sich Tag für Tag für kaum mehr als nichts bis zum Umfallen abzurackern, und sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit so schnell wie möglich vom Acker gemacht hätten, wie es der genetisch verankerte (Über-) Lebenswille verlangt.
Die von manchen gesehene, andere Analogie, nämlich der unter erbärmlichsten Bedingungen von den Überlebenden – mit maximaler Kraftanstrengung aller – erfolgte Wiederaufbau nach einem alles zerstörenden Krieg oder einer verheerenden Naturkatastrophe, ist bei näherer Betrachtung allerdings untauglich.
Denn solchen Kraftakten wohnt von Anfang an der Wille inne, aus der totalen Zerstörung mit vereinten Kräften ein Wachstum, und zwar ein Wachstum des Wohlstands hervorzubringen. Dieser Wille findet aber sein Ende nicht von alleine darin, dass ein etwas befriedigenderer Zustand wieder hergestellt werden kann, sondern er führt, wenn das Schlimmste überstanden ist, wieder in den Wettbewerb und in das vom Wettbewerb erzwungene Wachstum und letztlich nach einigen Jahrzehnten zu einem neuerlichen Systemzusammenbruch.
Bleiben wir also noch bei der Sklavenwirtschaft. Was sind Sklaven ohne „Herren“?
Eine törichte Frage. Ohne Herren kann es keine Sklaven geben!
Eine freie Gesellschaft, in der die Menschenrechte etwas gelten, wird sich niemals durch ein einheitliches, bedingungsloses Grundeinkommen zu jener altruistischen Bescheidenheit aller ihrer Individuen bringen lassen, wie sie der Plan der gerechten Verteilung des bewusst herbeigeführten Mangels erfordert.
Wer an den dazu erforderlichen „besseren Menschen“ glaubt, der von selbst in die Welt träte, wenn das System nach ihm verlangt, wird bitter enttäuscht werden. Um ein solches System dennoch zu etablieren, muss es letztlich alle Züge eines Sklavenhalter-Systems tragen und die Menschen in die ihnen zugedachte Rolle zwingen und sie mit Drohungen und Strafen darin halten.
Selbstverständlich werden jene, die ausersehen sind, den notwendigen Zwang auszuüben, sich nicht mit dem allgemeinen Grundeinkommen zufrieden geben, sondern darüber hinaus zusätzliche Leistungen und Privilegien fordern.
Schon ist zumindest eine Drei-Klassen-Gesellschaft entstanden. Unten die Masse, in der Mitte die Gefängniswärter und oben die Herrschenden. Dass sich diese Gesellschaft weiter ausdifferenzieren wird, ist unvermeidlich, und weil jede Rangstufe ihre Extras für sich beanspruchen wird, besteht schon wieder die Notwendigkeit des Wachstums, es sei denn, man verweigert der Masse noch mehr von dem angeblich für alle gebackenen Kuchen.
Das hat dann übrigens in Frankreich am 14. Juli 1789 zur Revolution geführt.
Häufig erlebe ich, dass ich zufällig auf die Schriften und Theorien interessanter Menschen stoße, aus denen ich Futter für meine eigenen Überlegungen beziehen kann. So bin ich gestern, eigentlich auf der Suche nach einem Brecht-Zitat auf einen Aufsatz des mir bis dahin vollkommen unbekannten Werner G. Petschko gestoßen, zu dem auch das Internet kaum etwas mehr als seinen Namen weiß. Doch in diesem Aufsatz sind mir drei Sätze aufgefallen, die ich an dieser Stelle einfach einflechten muss. Petschko schreibt:
In meinen Augen hat die Vergangenheit zur Genüge gezeigt,
dass Moral allein, ohne Logik,
nicht selten zur wüstesten Schreckensherrschaft geführt hat.
Die reine Logik aber, die kalt und formal über das Einzelne hinwegabstrahiert,
gerät ebenso oft zur Tyrannei.
Auch dafür gibt es jede Menge geschichtliche Beispiele.
Das korrespondiert nur insoweit mit der Unterscheidung in Gesinnungs- und Verantwortungsethik, als die Gesinnungsethik, alleine gestützt auf ihr Wertegerüst, zwar ohne Logik auskommen kann, die Verantwortungsethik jedoch sowohl die Logik als auch den moralischen Kompass braucht, um Verantwortung überhaupt wahrnehmen zu können.
Im Rückschluss ergibt sich, dass nacktes ökonomisches Kalkül als Regel für das gesellschaftliche Zusammenleben ebenso ungeeignet ist, wie ein moralisch-emotionales Streben, das die Wahrnehmung und Beachtung dem entgegenstehender Erkenntnisse der Logik schlicht verweigert.
Unglücklicherweise ist dieses Gegensatzpaar bestens dazu geeignet, seine Existenz als Gegensatzpaar immer wieder neu zu provozieren, so bald nur eine der beiden Wesensarten in Erscheinung tritt.
Die nackte Gier des entfesselten Kapitalismus – ob nun in seiner weltweiten Gesamtheit oder im konkreten Einzelfall des raffgierigen Geizigen erscheinend – ruft unweigerlich emotional-moralische Gegenreaktion der Behüter und Beschützer der Ausgebeuteten und Unterdrückten hervor. Dann wird – zurecht – nach Gerechtigkeit und Umverteilung von oben nach unten gerufen, und es wird zusätzlich Ausschau gehalten, ob sich sonst noch Benachteiligte finden lassen, um auch sie von der Umverteilung profitieren zu lassen, weil es die Menschlichkeit gebietet.
Doch was ruft das auf der Gegenseite hervor: Den dringenden Wunsch, das eigene Vermögen vor der Begierde des Umverteilungsstaates in Sicherheit zu bringen, und je weniger das gelingt, die eigene privilegierte Position bis zum Anschlag auszunutzen, um sich über höchste Preise bei kostensparendster Produktion genau das, und möglichst noch mehr, zurückzuholen, was ihnen – teils vermeintlich, teils tatsächlich – in ungebührlicher Weise genommen wird.
Es ist möglicherweise das vertrackteste Henne-Ei-Problem, das im Bereich des menschlichen Zusammenlebens aufzufinden ist.
Doch anders als bei der Frage: „Wer war zuerst da?“, bietet sich hier, weil es sich nicht um eine zeitliche Abfolge, sondern um ein permanent gleichzeitiges Phänomen mit abwechselnden Unter- und Überlegenheitspositionen beider Seiten handelt, die Chance, ein salomonisches Urteil anzudenken:
Es tragen beide Seiten jeweils die hälftige Schuld
am unverstandenen Handeln der anderen Seite.
Diese Feststellung ändert nichts an der Situation als solcher, aber es hilft, die Ursachen zu verstehen, was schließlich die Voraussetzung dafür ist, Ansatzpunkte für Verbesserungen zu suchen.
Nur: Wo gibt es noch den neutralen Sachwalter, der versuchen könnte, einen vernünftigen und wirklich gerechten Ausgleich herzustellen? Es gibt nur die beiden Fronten – und weder darüber noch dazwischen eine Macht, welche die Übertreibungen beider Seiten einhegen könnte. Was hilft das schönste Grundgesetz, die beste Verfassung für den demokratischen und sozialen Bundesstaat, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, wenn niemand da ist, der diese Regelungen durchsetzen will, und so er will, auch durchzusetzen vermöchte?
Das Grundgesetz unterstellt ein ungebrochenes und vollkommen gerechtfertigtes Vertrauen in die staatlichen Institutionen, in die Gewaltenteilung und vor allem in die Funktionsfähigkeit eines auf die bestmöglichen Kompromisses hinarbeitenden Parlaments.
Dass dieses Vertrauen immer noch gerechtfertigt sei, behaupten nur diejenigen, die sich die Leichtgläubigkeit der Bürger gerne zu Nutze machen wollen.
Letztlich ist es immer noch so, wie es seit der Steinzeit ist: Die Quantität und die Qualität der Gewaltmittel bestimmt darüber, nach welcher Seite das Pendel ausschlagen wird. Das Versprechen von Wachstum und Wohlstand kann jederzeit vom Versprechen von Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Gleichheit abgelöst werden, so wie auch das Versprechen der Überwindung einer Pandemie oder einer drohenden Klimakatastrophe die Oberhand gewinnen kann, wenn die Gewaltmittel zur Durchsetzung vorhanden sind.
Dabei sind Gewaltmittel längst nicht mehr nur Waffen im herkömmlichen Sinne, sondern auch alle Mittel zu subtilen Beeinflussung der Massen, wie sie von den Medien dem Meistbietenden zur Verfügung gestellt werden.
Ein schwacher Trost ist dabei, dass – egal, wer auch immer die Macht- und Führungspositionen einnimmt und sein Programm bis zum bitteren Ende durchzieht – dieses bittere Ende immer in den Zusammenbruch der herrschenden Ordnung mündet.
Der technische Fortschritt, der die Welt in unserer Vorstellung auf eine kleine blaue Kugel im Anziehungsbereich der Sonne hat zusammenschrumpfen lassen, hat auch dafür gesorgt, dass die Zeiträume zwischen Aufstieg und Untergang einer Ordnung von Jahrhunderten und Jahrtausenden auf bestenfalls wenige Jahrzehnte zusammengeschrumpft sind.
Alleine für Deutschland gilt, dass die Reichsgründung von 1871 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, 1918, in eine erste, ziemlich gärige Demokratie übergegangen ist, die 1933 durch eine Diktatur abgelöst wurde, die wiederum schon nach zwölf Jahren vom Sockel gestoßen wurde, um einem pseudorepublikanischen Besatzungsregime zu weichen, das bis 1989 teils offen, teils verdeckt seine Wirksamkeit entfaltete und sich dann in rasender Geschwindigkeit vom Ideal des demokratischen und sozialen Bundesstaates entfernte, um sich in einen Garten links-grüner Fantasien zu verwandeln, deren Ende mit der Nagelprobe, nämlich der Übernahme der Regierungsverantwortung, bereits besiegelt ist, auch wenn der Zusammenbruch erst noch bevorsteht.
Leider kann ich keine bessere Prognose abgeben, als die, dass für dieses Hin- und Her, für das Gerangel um die Vorherrschaft und die damit verbundenen, unseligen Richtungswechsel kein Ende absehbar ist.
Alles, was möglich ist, besteht für die an der Macht Befindlichen darin, den Zusammenbruch hinauszuzögern, und für die „Konkurrenz“ besteht das Mögliche darin, den Zusammenbruch beschleunigt herbeizuführen.
Der Dualismus ist das Prinzip unserer Welt in unserem Universum. Es ist das Prinzip des Geborenwerdens und des Sterbens, des Fressens und Gefressen-Werdens. Die Gnus fressen Gras, der Löwe frisst Gnus, Würmer und Mikroben fressen am Ende den Löwen und aus deren Ausscheidungen wächst wiederum Gras.
- Wenn Du also eine Mikrobe bist, wirst Du irgendwann einem Regenwurm als Nahrung dienen.
- Wenn Du aber ein Wurm bist, wird Dich irgendwann der Maulwurf oder ein Vogel fressen, während Deine mit Deinen Gängen gefüllten Ausscheidungen immer noch dem Gras als Nahrung dienen.
- Solltest Du dummerweise Gras sein, werden Dich die Gnus ausrupfen und verdauen.
- Bist Du gar ein hübsches, wendiges, schnelles Gnu, wird Dich der Löwe schlagen und sich gemeinsam mit den Geiern an Dir laben.
- Der Löwe aber ahnt nicht, dass er eines schönen Tages wehrlos von Würmern und Mikroben bis auf das nackte Gerippe aufgefressen werden wird.
So wird, nicht etwa erst eines fernen Tages, sondern in jedem Augenblick aus der bestehenden Ordnung eine neue Ordnung geboren, wobei sich die Umbrüche nur im mikroskopischem Maßstab und kürzesten Zeiträumen wie Katastrophen anfühlen. Insgesamt, und das ist meine feste Überzeugung, führt die Wellenlinie der Höhe- und Tiefpunkte auf einen Punkt der Vollkommenheit zu, der in weiter Fer-ne zu erahnen ist.
Zum Schluss noch eine äußerst abwegige Überlegung zur Klimaneutralität im Verkehr:
Ein Lastenfahrrad wird selbst in der Ebene, schon alleine wegen der sonst unzureichenden Bremswirkung, kaum mehr als 50 kg bewegen können und damit im Laufe eines Acht-Stunden-Tages – wenn’s hochkommt – vielleicht 150 Kilometer zurücklegen. Das entspricht einer Leistung von knapp 1,0 Tonnenkilometern pro Stunde. Der Fahrer dieses Lastenfahrrads wird für diese Leistung zusätzlich zu seinen etwa 2.000 kcal Grundumsatz weitere 3.000 kcal für die Bewegungsarbeit verbrauchen. Das heißt, der Energieaufwand für 1,0 Tonnenkilometer beträgt 375 kcal.
Ein voll beladener 40-Tonner LKW mit einer maximalen Zuladung von 25 Tonnen wird im Laufe eines Acht-Stunden-Tages etwa 500 bis 600 Kilometer zurücklegen. Das entspricht einer Leistung von rund 1710 Tonnenkilometern pro Stunde. Der Motor dieses LKWs verbraucht pro 100 Kilometer Fahrleistung des voll beladenen LKWs rund 30 Liter Dieselkraftstoff. Die Energiemenge von 30 Liter Dieselkraftstoff entspricht rund 350.000 Kcal. Daraus ergibt sich ein Energieverbrauch von etwa 130 kcal pro Tonnenkilometer.
Da die CO2-Belastung aus der Atemluft mit der körperlichen Leistung ebenso ansteigt, wie die CO2-Belastung aus dem LKW-Auspuff mit der erforderlichen Motorleistung, sieht es bezüglich der Klimaneutralität des Lastenfahrrades bei annähernd etwa 3-fachem CO2-Ausstoß pro Tonnenkilometer eher nicht so toll aus.
Beim Verbrauch an Verkehrsfläche (Flächenfraß) müssen für ein Lastenfahrrad, mit 5 Meter Abstand vorne (hinten ist das die dem nachfolgenden Lastenfahrrad zuzurechnende Abstandslänge), etwa 8 Quadratmeter angesetzt werden. Für den 40-Tonner LKW sind das, bei 50 Meter Abstand vorne, etwa 200 Quadratmeter. Pro Tonne Transportgut werden jedoch 20 Lastenfahrräder (160 m²) benötigt, aber nur 0,04 LKWs (8 m²), das bedeutet, dass das bewegte Lastenfahrrad in jedem Augenblick die 20-fache Verkehrsfläche beansprucht. Da das Lastenfahrrad jedoch für die gleich Strecke etwa die dreifache Zeit benötigt, läuft es letztlich auf den 60-fachen Bedarf an Verkehrsfläche hinaus.
Dass sich diese Relationen zu Gunsten des Lastenfahrrads umkehren würden, wenn man nicht den 40-Tonner zum Vergleich heranzieht, sondern den Kastenwagen des großstädtischen Handwerkers, ist übrigens eine sehr optimistische Annahme.
Erst wenn der Wocheneinkauf im 1,5 km entfernten Supermarkt statt mit dem SUV mit dem Lastenfahrrad transportiert wird, wird sich in Bezug auf den Energieverbrauch eine Entlastung ermitteln lassen können, während der auf die Fahrzeit bezogene Flächenverbrauch annähernd gleich bleibt.
Zu betrachten ist auch noch der Aspekt der durch Transportarbeiten beanspruchten Lebenszeit. Da kommt das Lastenfahrrad nur noch für diejenigen infrage, die sonst nichts zu tun haben und den Zeitverlust daher nicht zwingend als Verzicht wahrnehmen müssen.