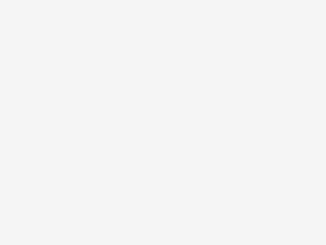PaD 45 /2013 Hier auch als PDF verfügbar: PaD 45 Was heißt eigentlich Digitalisierung
Lavazza macht zur Zeit Werbung mit der Frage: „Was ist ein echt italienischer Kaffee?“, und gibt gleich mehrere gültige Antworten darauf.
Wäre doch schön, wenn es auf die Frage, was denn „Digitalisierung“ eigentlich ist, Antworten gäbe, die ähnlich konkret greifbar wären, wie beim Kaffee. „Espresso“, „Cappuccino“, „Latte macchiato“, und so weiter.
Diese Antworten gibt es jedoch nicht, es gibt noch nicht einmal etwas, das dem 2%-Ziel der Klimaretter entspräche, denn „Digitalisierung“, die nun nachweislich und ausschließlich menschengemacht ist, lässt sich definitiv nicht aufhalten. Daher wird die Digitalisierung zur Herausforderung verklärt, der wir uns alle zu stellen haben. Punkt.
Manchmal hat es Vorteile, schon ein bisschen älter zu sein als Habeck und Greta. Da kann man sich nämlich an Dinge aus eigenem Erleben erinnern, von denen andere noch nicht einmal in der Schule noch etwas gehört haben. Zu den Dingen aus dem eigenen Erleben als Lehrling gehört die Bekanntschaft mit einer Tabelliermaschine namens Bull Gamma 10, eine ganz und gar erstaunliche Weiterentwicklung dessen, was Hermann Hollerith schon im Jahre 1890 zur Beschleunigung der Auswertung der Informationen aus der US-Volkszählung eingesetzt hatte. Also eine Lochkartenmaschine.
Die Lochkartenmaschine war insofern bereits „digital“ als sie beim Abtasten des Speichermediums „Lochkarte“ nur zwischen „Loch“ und „kein Loch“, also zwischen „null“ und „eins“ unterscheiden konnte. Das „Duale Zahlensystem“ spielte jedoch nur eine untergeordnete Rolle, denn die Tabelliermaschine hatte nicht wirklich einen Speicher, sondern nur etwas, was wir heute „Register“ nennen würden. Ihr Programm wurde – das kann man sich heute nicht mehr vorstellen – mittels Drahtverbindungen auf großen Stecktafeln realisiert, und damit das Programm überhaupt laufen konnte, waren die Lochkarten vorher zu sortieren und die sortierten ggfs.mit anderen sortierten zu mischen. Erst wenn der Stapel so vorbereitet war, konnte der beim Einlesen durch ein bestimmtes Loch in der Lochkarte fließende Strom an einem bestimmten Loch der Stecktafel abgegriffen und mittels des vom Programmierer gesteckten Drahtes an ein anderes Loch in der Stecktafel geleitet werden, womit dann „die programmierte Funktion“ ausgelöst wurde.
So primitiv diese Form der Datenverarbeitung aus heutiger Sicht auch war, der Nutzen war immens! Dass damals nicht Millionen von Büroangestellten in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden, lag ausschließlich daran, dass die Effizienzsteigerung per Datenverarbeitung die Bewältigung des Produktionswachstums überhaupt erst möglich machte. In den späten 50er und frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts war es das Ziel der Produktivitätssteigerung, mit den verfügbaren Arbeitskräften den größtmöglichen Produktionsoutput zu erzeugen.
Als die ersten echten Elektronen-Gehirne die elektromechanischen Maschinen ablösten, weil sie – obwohl immer noch schier unbezahlbar – die Verheißung in sich trugen, damit so viel menschliche Arbeit einzusparen, dass sie sich ganz schnell amortisieren würden, ging es noch einmal um die Beherrschung von „Massendaten“, die jedoch in komplexeren betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen anfielen, wo auch „teurere“ Mitarbeiter von den Maschinen ersetzt werden konnten. Gleichzeitig begannen Ingenieure und Konstrukteure damit, einfache Teile ihrer Arbeit in Programme zu gießen und Bau- und Konstruktionspläne nicht mehr an großen Zeichentafeln langsam mit Lineal und Tuschfeder zu erzeugen, sondern sie von Plottern um einiges schneller – und vor allem sehr viel einfacher korrigierbar – „auf die Papierbahnen malen“ zu lassen.
Elektronische Steuerungen von Maschinen und Fertigungsstraßen wuchsen gleichzeitig heran, jedoch auf einer ganz anderen Basis. Kleine Module mit einem kleinen, programmierbaren Funktionsumfang konnten einzeln oder in komplexeren Kombinationen mehrerer gleichartiger Elemente eingesetzt werden, um die Automatisierung von Fertigungsprozessen voranzutreiben. Im großen Maßstab griff die Elektronik jedoch erst in die Fertigung ein, als die CNC-Steuerung für Werkzeugmaschinen einsatzbereit war, was es zum Beispiel ermöglichte, auch sehr komplizierte Drehteile, auch mit mehrfachem Werkzeugwechsel nach einmaliger Programmierung vollautomatisch herzustellen.
Das Zusammenwachsen der Insellösungen in der Fertigung mit den Insellösungen in der Verwaltung ging relativ zügig vor sich, weil es schlicht Unfug gewesen wäre, Daten, die bereits in digitaler Form vorlagen auf irgendeinem manuellen Wege für eine andere digitale Anwendung zu erfassen.
Jeder dieser Entwicklungsschritte finanzierte sich daraus, dass die damit möglich gewordenen Einsparung von Personalkosten die Mehrkosten für Investition und Wartung der Informationstechnologie deutlich überstiegen, bald aber auch dadurch, dass das verkaufsfähige Produkt ohne den Einsatz von Computern gar nicht hätte hergestellt werden können, weil Menschen weder über die Präzision noch über die ggfs. notwendige Reaktions-/Entscheidungs-Geschwindigkeit, noch über die physischen Fähigkeiten (Kraft, Größe, Unempfindlichkeit, Ausdauer, etc.) der Maschinen verfügen, die für die Produktion unabdingbar ist.
Dass es heute riesige Werkhallen gibt, in welchen hunderte von Robotern ein gespentisches Ballett aufführen, ohne dass mehr als zwei oder drei Menschen zwischen den Maschinen herumhuschen, ist die Realisierung eines Traumes, der seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts geträumt wurde und Schritt für Schritt per „Digitalisierung“ wahrgemacht wurde.
Digitalisierung ist also nichts Neues.
Was uns bevorsteht, ist nicht die Herausforderung der Digitalisierung,
sondern der Abschluss:
Die Vollendung der Digitalisierung.
Was uns bevorsteht, das ist der Tag, an dem es keinen Menschen mehr braucht, um die Menschheit zu versorgen.
Was uns bevorsteht, das ist der Tag der großen, allgemeinen Wertlosigkeit.
Wenn niemand mehr eine Arbeit findet, weil alle Arbeit von vollautomatischen, sich selbst wartenden und selbt reproduzierenden Maschinen erledigt wird, weil Roboter als Polizisten und Soldaten ebenso Dienst tun, wie als Ärzte, Komponisten, Bildhauer und Prostituierte, steht uns das Verteilungsproblem überhaupt bevor. Die Damen und Herren Eigentümer der Maschinen, die ständig Überfluss hervorbringen, haben keinen Gewinn mehr davon, weil niemand mehr „Geld“ hat, um die Produkte zu bezahlen.Und selbst wenn sie Geld hätten und bezahlen könnten, wie lange würde dieses Geld reichen, und vor allem: Was sollten die Eigentümer mit diesem Geld anfangen, wenn sie sich eines nicht allzufernen Tages dafür alles gekauft haben werden, was es noch zu kaufen gab?
Die Spatzen pfeifen es längst von den Dächern, dass wir auf genau diese Situation zulaufen.
Nachdem der letzte Mitarbeiter der Rationalisierung zum Opfer gefallen sein wird, müssen entweder die Maschinen abgeschaltet werden, weil es keine Nachfrage mehr gibt, oder der Lebensstandard der Eigentümer gleicht sich dem Lebensstandard der Nicht-Eigentümer an.
Die Lösung des Dilemmas wäre die reine Dienstleistungsgesellschaft. In meiner Jugend gab es dazu den Spruch: „Für Geld kannst du dir Federn in den Hintern blasen lassen.“
Doch der Dienstleistungssektor ist inzwischen so weit von der „Digitalisierung“ durchdrungen, dass damit auch kein Staat mehr gemacht werden kann.
Die andere Lösung wäre eine Weiterentwicklung dessen, was die Chinesen gerade testen. Ein an „Sozialpunkte“ gekoppeltes Einkommen, das nichts anderes darstellt, als das Maß der zugestandenen Teilhabe an der Produktivität der Maschinen. Wobei die insgesamt verfügbare Geldmenge (natürlich nur digitales Geld) exakt ausreicht, um die bereitgestellten Produkte abzusetzen. Raffinierte Algorithmen machen dabei auch Spar- und Entsparprozesse möglich, ohne dass diese negative Auswirkungen auf den Umfang der möglichen Transaktionen hätten.
Das Problem dabei besteht darin, dass nicht mehr die für die Gesellschaft erbrachte Leistung als Kriterium für die Entlohnung herangezogen werden kann, weil ja niemand mehr Leistungen erbringt, sondern nur noch das Maß an Wohlverhalten im jeweils herrschenden Wertesystem.
Die Weiterung des Problems entsteht dadurch, dass ein einmal installiertes Wertesystem nach dem Tag der großen, allgemeinen Wertlosigkeit nicht mehr verändert werden kann. Bis dahin sind Anpassungen möglich, bis dahin gehören nämlich auch Freiheitsgrade für die letzten unverzichtbaren menschlichen Leistungsträger zum Entlohnungssystem und können zwischen den noch Unverzichtbaren und der „Gesellschaft“ ausgehandelt werden. Danach gibt es diese fruchtbaren Spannungsverhältnisse nicht mehr, weil sich eine Veränderung durch nichts mehr begründen ließe und jede Veränderung, in diesem eingefrorenen Zustand, eine willkürliche Begünstigung für die eine Gruppe und eine willkürliche Benachteiligung für die andere Gruppe darstellen würde.
Die glorreiche Idee, schon die Jüngsten in Kindergarten und Schule fit für die Digitalisierung zu machen, ist – im Wettbewerbsmodell gedacht – sicherlich der richtige Weg, um – solange noch Wettbewerb herrscht – zu den „Siegern“ zu gehören, führt aber, falls der Plan gelingt, doch nur dazu, dass der Tag der großen, allgemeinen Wertlosigkeit früher erreicht sein wird.
Die „Herausforderungen der Digitalisierung“, von denen die Klugscheißer auf ihren Parteitagen so trefflich zu parlieren wissen, bestehen nicht darin, die Arbeitnehmer für die Jobs in der digitalen Welt fit zu machen, sie bestehen nicht darin, den Kindern und ihren Eltern so viel Medienkompetenz zu vermitteln, dass sie selbst im Schlaf noch das politisch korrekte Angebot allen anderen vorzuziehen vermögen, auch nicht darin, neue Produkte und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu ersinnen und zu verwirklichen. Es gibt nur eine Herausforderung der Digitalisierung, und diese Herausforderung besteht in der sozialverträglichen und unblutigen Lösung des Verteilungsproblems.
Seit dem Zeitpunkt, an dem es gelungen ist, die Produktivität durch Automatisierung so weit zu steigern, dass die auf dem Markt anzutreffende Nachfrage mit einer sinkenden Zahl von menschlichen Arbeitsstunden befriedigt werden konnte, also seit etwa 35 bis 40 Jahren, wurde die Verteilungsfrage immer problematischer, doch das Anwachsen der Arbeitslosigkeit zerstörte die Solidarität unter den „Arbeitsbedürftigen“ und schwächte die Gewerkschafte, so dass der Sozialstaat gezwungen schien, den Glücklichen mit Arbeit so viel von ihrem Lohn wegzunehmen, dass die Unglücklichen ohne Arbeit auch noch ein gutes Leben in bescheidenem Wohlstand führen konnten.
Mit der weiteren Verschiebung der Gewichte zwischen Beschäftigten mit ausreichenden bis guten Einkommen und den Arbeitslosen und den prekär Beschäftigten, konnte dieser Ausgleich aus den Töpfen von Sozialversicherung und Steuersäckel nicht mehr hergestellte werden. Schröder kündigte daher 2002 weite Teile des Sozialstaatsvertrags auf und schuf mit den „Hartz-IV-Beziehern“ jene Kaste der Unberührbaren, deren Teilhabe auf das Existenzminimum beschränkt wurde, jener Kaste, deren Existenz – trotz weiter gewachsener Produktivität – von der Gesellschaft, die ja diese Situation durch Mehrheitsentscheidung bei Wahlen geschaffen hat, nur noch widerwillig geduldet und daher nach Kräften durch Sanktionen erschwert wurde.
Diesen Weg weiterzugehen, hieße, das Verteilungsproblem weiterhin nicht lösen zu wollen.
Wenn noch ein paar Millionen vernünftig bezahlte Vollzeitstellen wegfallen, ist das heutige Niveau der Regelsätze nicht mehr zu halten. Wenn man uns auch bisher immer nur die Rentnerschwemme an die Wand gemalt hat, die irgendwann dazu führen müsse, dass ein Arbeitnehmer einen Rentner zu ernähren habe, dann war und ist das Lüge durch Weglassung! Die Arbeitslosen, die Aufstocker und deren Familien hängen ebenfalls an den immer weniger werdenden Jobs – doch deren Löhne steigen nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre, um daraus die Verteilungsproblematik zu lösen.
Die Konsequenz des „Weiter-So“ besteht darin, tatsächlich und ganz bewusst innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne etwa 99 Prozent der Menschheit, also mehr als 7 Milliarden Menschen, vorsätzlich von jeglicher Teilhabe auszuschließen und verhungern zu lassen.
Das wird nicht gelingen, weil es nicht genug Drohnen, Panzer, Raketen, Maschinengewehre und Landminen gibt, um den Strom von 7 Milliarden aufzuhalten, die bereits lange vor dem endgültigen „Aus für alle“ aufbrechen werden, um sich zu nehmen, wessen sie bedürfen, zumal es überall aus den Maschinen quillt, bzw. quellen würde, würde man sie wieder einschalten.
Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Vollendung der Digitalisierung zur großen allgemeinen Entwertung – und damit auch zur großen, allgemeinen Entmenschlichung wird!
Wir müssen schon heute damit beginnen, neue Maßstäbe der Wertschätzung außerhalb des Materiellen zu finden!
Wir müssen den Konflikt zwischen Eigentum und Teilhabe auflösen, indem wir für beides ein menschliches und ein würdiges Maß finden, indem wir lernen, zwischen aggressivem, destruktivem, erpresserisch-ausschließendem Eigentum einerseits, und sinnvollem, nützlichem Eigentum andererseits, zu unterscheiden.
 Als die Situation noch längst nicht so dringlich war wie heute, habe ich die Problematik im vierten Band meiner wahnwitzigen Wirtschaftslehre „Eigentum und Teilhabe“ ausführlich behandelt. Ein paar Exemplare der Printausgabe gibt es noch, vor allem aber ist der Band weiterhin auch als PDF oder als EPUB-Datei zu haben.
Als die Situation noch längst nicht so dringlich war wie heute, habe ich die Problematik im vierten Band meiner wahnwitzigen Wirtschaftslehre „Eigentum und Teilhabe“ ausführlich behandelt. Ein paar Exemplare der Printausgabe gibt es noch, vor allem aber ist der Band weiterhin auch als PDF oder als EPUB-Datei zu haben.