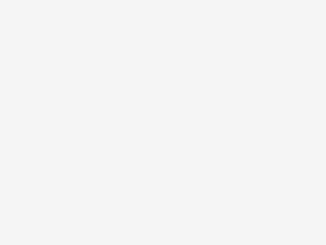Steigende Löhne? Geld ist in jeder Menge machbar.
Früher war alles besser.
In meiner Erinnerung war Streik vor vierzig, fünfzig Jahren noch etwas, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vermeiden suchten. Das alljährliche Ritual begann damit, dass eine Gewerkschaft aus dem DGB, oft die IG Metall, in einem ihrer Tarifgebiete, oft in Bayern oder Baden-Württemberg, den Reigen eröffnete. Da hat die Gewerkschaft ihre (bescheidene) Maximalforderung vorgetragen und die Arbeitgeber haben ungefähr ein Drittel davon angeboten. Darüber wurde dann verhandelt, und noch einmal verhandelt. Mit einem Warnstreik von drei Stunden Dauer am Freitgagnachmittag wurde ein Zeichen gesetzt, und dann einigte man sich auf einen Wert in der Mitte zwischen Forderung und Angebot, während über die Laufzeit der Tarifvereinbarung gar nicht gesprochen wurde, denn das waren grundsätzlich zwölf Monate.
Nachdem so der Kurs vorgegeben war, folgten die so genannten Tarifauseinandersetzungen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der anderen Branchen, die sich am Abschluss der Metaller orientierten, und fertig.
Gut, ich gebe zu, ganz so einfach war es nicht immer. Manchmal gab es tatsächlich Streiks, manchmal im Gegenzug sogar Aussperrungen, gelegentlich gab es auch einen Schlichterspruch, dem dann allerdings beide Seiten schleunigst zugestimmt haben, aber das waren doch eher die Ausnahmen.
Ich wage dazu eine simple Erklärung:
Die Beschäftigten waren sich zwar bewusst, dass Streik im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist, aber wer streikte, der stellte sich schon ins Abseits. Es war nicht „fein“ zu streiken.
Die Gewerkschaften galten als „links“, im Sinne von sozialistisch, und links war damals überhaupt nicht sexy. Die Chefs und die Führungskräfte hingegen waren konservativ und achteten sehr auf die so genannten Sekundärtugenden, von der Pünktlichkeit angefangen. So fanden die Gewerkschaften ihre Mitglieder auch ganz überwiegend unter den Arbeitern, aber kaum unter den Angestellten, die auch insofern weiter privilegiert waren, dass sie noch bis 2005 ihre Beiträge in die eigene gesetzliche Rentenversicherung für Angestellte (BfA) einzahlten.
Selbstverständlich vermerkten die Arbeitgeber fein säuberlich, wer sich an einem Streik beteiligt hatte. Das blieb zwar in der Masse ohne Folgen, doch im Einzelfall konnte es schon auch einmal einer Beförderungssperre gleichkommen. Es war nicht gut zu streiken – und auch deshalb funktionierte das deutsche Modell der friedlichen „Tarifpartnerschaft“ so lange so reibungslos.
Ein weiterer, sehr wirksamer Aspekt für die friedliche Kooperation zwischen Arbeitegebern und Arbeitnehmern muss auch darin gesehen werden, dass die meisten Beschäftigten einst so etwas wie Stolz auf ihre Arbeit und „ihr“ Unternehmen entwickelten. Egal ob es nun die Zeche Zollverein war, wo man als Hauer oder Steiger dem Berg die Steinkohle abgerungen hat, ob man bei SIEMENS, bei Volkswagen, bei der Bundesbahn oder bei der Deutschen Bank beschäftigt war, ob als Lehrling im ersten Jahr oder als Abteilungsleiter kurz vor dem vierzigjährigen Dienstjubiläum, das machte keinen Unterschied. Da gab es eine gewachsene Unternehmenskultur, lange bevor die Unternehmensberater sie mit künstlich geschaffener „Corporate Identity“ zu zerstören begannen. Was für die großen Namen der Konzerne galt, galt aber ebenso auch für die kleinen Handwerksbetriebe, für die Einzelhändler, ja selbst für die städtische Müllabfuhr. Das waren „Familien“, die miteinander ein Ziel verfolgten, Familien, in denen miteinander hart gearbeitet, aber auch oft und ausgelassen gefeiert wurde.
Außerdem ging es sowieso über viele, viele Jahre stetig bergauf. Der Facharbeiter, der seine Familie alleine ernähren konnte, sich ein Auto und den Urlaub an der Adria leisten konnte, ohne dafür einen Kredit aufnehmen zu müssen, war die Regel, und bei nicht wenigen stand auch das eigene Häuschen schon zehn Jahre vor der Rente schuldenfrei da.
Das alles ist – abgesehen von jenen Ausnahmen, die immer die Regel bestätigen – Vergangenheit.
Jetzt gehen sogar schon die angestellten Ärzte der Krankenhäuser auf die Straße, wie am Montag gerade wieder einmal, und fordern nicht nur mehr Geld, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen. Es ist nachvollziehbar. Die Arbeitsbelastung ist hoch, weil die Personaldecke überall zu kurz ist, und die Inflation der letzten Jahre hat erhebliche Löcher in die Geldbeutel gerissen. Warum fordert die GDL denn eine Lohnerhöhung um mindestens 500 Euro pro Monat? Weil das Geld allzuschnell wieder verschwindet, obwohl man sich eher weniger leistet als noch vor fünf Jahren. Warum sah sich die Bundesregierung veranlasst, aus Hartz-IV das Bürgergeld zu stricken und die Transferleistungen innerhalb von nur 12 Monaten um 25 Prozent anzuheben? Eine Erhöhung, die wegen des Lohnabstandsgebots jetzt übrigens auch den unteren Besoldungsgruppen der Beamtenschaft zugute kommt.
Wenn wirtschaftliche Verschlechterung auf Beschäftigte trifft, die sich mit ihrem Unternehmen nicht mehr identifizieren wie früher, und dies in einer vom linken Denken dominierten Gesellschaft, die sehr viel stärker den Ruf nach gleicher Teilhabe unterstützt als auch adäquate Leistung einzufordern, ergibt das jenes Gebräu, dessen Genuss enthemmt und mutig macht, wenn es um maximale Forderungen und wilde Streikbereitschaft geht, aber zugleich blind macht für die Folgen des eigenen Handelns.
Dies übrigens auf beiden Seiten.
- Wo Politiker der Bevölkerung Steuern und Abgaben erhöhen und sich gleichzeitig einen kräftigen Schluck aus der Diätenpulle genehmigen, obwohl sie das Land in die Rezession rutschen lassen,
- wo sich Unternehmensvorstände dicke Boni zahlen lassen, während sie die inländischen Belegschaften reduzieren,
- wo es für die Leistungsträger fast keinen Unterschied mehr macht, ob sie brutto 3.000 oder 5.000 Euro auf dem Gehaltszettel stehen haben, weil der Mehrverdienst nicht nur mit höheren Steuern und Abgaben, sondern auch mit dem Wegfall staatlicher Leistungen bezahlt werden muss,
da regt sich Unmut – und der äußert sich eben darin, dass diejenigen, die sich zwar nicht für unverzichtbar, aber doch zumindest für schwer ersetzbar halten, mit der großen Streikfahne vorangehen und das erstreiten, was am Ende – in abgestufter Form – allen irgendwie zugute kommen wird.
Es ist verständlich – aber falsch.
Ohne näher auf die Problematik jener Zahl einzugehen, die als Brutto-Inlandsprodukt ermittelt wird und die nicht, wie regelmäßig behauptet wird, die Wirtschaftsleistung misst, sondern mit der Wirtschaftsleistung auch noch vieles andere, zum Beispiel auch die Kosten des gesamten Öffentlichen Dienstes und einen großzügig geschätzten Beitrag der so genannten Schwarzarbeit, sagen die offiziellen Zahlen doch zumindest, dass die Wirtschaftsleistung im IV. Quartal 2023 – preis-, kalender- und saisonbereinigt – um 0,3 Prozent geschrumpft ist. Die offiziellen Wachstumsprognosen für das laufende Jahr bewegen sich hart an der Wahrnehmungsschwelle und im Bereich des statistischen Fehlers. Alle Indikatoren lassen mich darauf schließen, dass das Jahr 2024 nicht mit einem minimalen Wachstum, sondern mit einem deutlichen Rückgang des bereinigten BIP beendet werden wird.
Wie sollen also höhere Löhne und Gehälter finanziert werden, wenn dem keine gestiegene Leistung gegenübersteht?
Dass die Preise gestiegen sind, ist in dieser Situation kein Argument für Lohnerhöhungen. Die Preise sind ja nicht gestiegen, weil die Unternehmen ihre Gewinne erhöhen wollten. Die Preise sind gestiegen, weil die Kosten für Material, Zulieferungen und Energie gestiegen sind. Es war knappheitsbedingte Teuerung, nicht Inflation.Es darf dabei angenommen werden, dass diese Kostensteigerungen nicht von allen Unternehmen vollständig in höheren Preisen an die Kunden weitergegeben werden konnten, wissen wir doch vom Bäcker um die Ecke, dass er lieber geschlossen hat, als abzuwarten, bis er Insolvenz anmelden muss. Was der Bäcker im Kleinen, ist die Chemie-Industrie im Großen. Die kann sich die deutschen Energiekosten nicht mehr leisten und wandert ab. Stahl, Aluminium, Zement, Düngemittel, und viele andere Unternehmen sind schon auf dem Sprung in die USA, nach Polen, Ungarn, nach Tschechien oder in die Türkei. Überall dort lässt sich günstiger produzieren als in Deutschland.
Es herrscht Wirtschaftskrieg,
und Deutschland hat in diesem Krieg
bereits mehr als eine Schlacht verloren.
Die wirtschaftliche Basis des deutschen Wohlstands ist schwer beschädigt. Die Wertschöpfung ist zurückgegangen und bleibt weiterhin rückläufig. Da gibt es nicht immer noch mehr zu verteilen. Da hilft auch der Boom der Rüstungsindustrie nicht weiter. Artilleriemunition kann man nicht essen. Verschenkte Schützenpanzer auch nicht, und die Waffen- und Munitionsbestände die im Zuge des Strebens nach Kriegstüchtigkeit angelegt werden, sind ebenfalls unverdaulich. Steuergeld, das dafür ausgegeben wird, gelangt zwar in die Taschen der Beschäftigten der Rüstungsindustrie, gar keine Frage. Doch im Endeffekt wird hier für eine Leistung bezahlt, die nicht dazu beiträgt, den Bedarf der Konsumenten zu decken. Es kommt schlicht mehr Geld in den Markt, ohne dass sich das Angebot vergrößern würde. Die logische Folge ist Inflation.
Gleiches gilt für jegliche Lohnerhöhung in allen anderen Branchen. Das Angebot wächst durch Lohnerhöhungen nicht. Die logische Folge ist Inflation.
Die Forderung nach Inflationsausgleich, so berechtigt sie aus der Sicht des einzelnen Konsumenten auch sein mag, treibt die Lohn-Preis-Spirale nur weiter an, kann sie aber nicht zum Stillstand und den Wohlstand nicht wieder zum Wachsen bringen.
Wäre die deutsche Volkswirtschaft ein geschlossener Binnenmarkt ohne dringend auf Importe und zugleich eine florierende Exportwirtschaft angewiesen zu sein, könnte man munter immer weiter an der Lohn-Preis-Spirale drehen. Es ist egal, ob das durchschnittliche Monatseinkommen bei 1.000 oder 10.000 Euro liegt, wenn das Kilogramm Brot im einen Fall fünf und im anderen Fall 50 Euro kostet. Der Lebensstandard bleibt gesichert. Allerdings geht die Inflation auch in diesem Szenario nicht spurlos an der Volkswirtschaft vorüber, denn die zu Beginn angesparten 1.000 Euro haben am Ende nur noch eine Kaufkraft von 100 Euro – und das kann nicht nur die schönste Altersvorsorge ruinieren, auch die Nachfrage, die sich zum Teil ja immer auch aus der Auflösung von Erspartem speist, leidet generell darunter.
Dass Spekulanten, die auf Inflation wetten, sich anfangs hoch verschulden, davon inflationsneutrale Sachwerte erwerben und die Kredite später mit weit wertloserem Geld zum Nennwert zurückzahlen, also mit der Inflation reicher werden, ändert nichts an der grundsätzlichen Schadwirkung.
Deutschland ist aber kein geschlossener Binnenmarkt. Rund die Hälfte des BIP wird vom Ausland bezahlt. Werden deutsche Waren teurer, weil die Löhne auf breiter Front steigen, leidet die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Die Auftragseingänge schwinden und damit auch die Arbeitsplätze. Entweder, weil das Unternehmen keinen Gewinn mehr erzielen kann, oder weil die Verlagerung ins Ausland den letzten Ausweg für das Unternehmen darstellt.
Auf der Importseite macht sich die Inflation zusätzlich bemerkbar, weil sich der Euro-Kurs im Verhältnis zu den wichtigsten Fremdwährungen zwangsläufig negativ verändert. Hier kann die EZB zwar versuchen, über die Zinspolitik gegenzusteuern, aber hohe Zinsen sind nun einmal für eine am Boden liegende Konjunktur ebenfalls eher tödliches Gift als heilsame Arznei.
Der politisch gewollte Verzicht auf sichere und preiswerte Energie und die
volkswirtschaftlichen Schäden aus den Sanktionen gegen Russland
sind mit Lohnerhöhungen nicht aus der Welt zu schaffen.
Wir sind ärmer geworden.
Die Tarifauseinandersetzungen sind daher reine Nullsummenspiele mit Gewinnern und Verlierern innerhalb des Kreises der abhängig Beschäftigten. Bestenfalls könnten sie dazu führen, dass ungerechtfertigte Einkommensunterschiede zwischen Branchen und Tätigkeitsarten ausgeglichen werden. Es ist jedoch eher damit zu rechnen, dass die Unterschiede verstärkt werden, weil diejenigen, die bereits die Stärkeren sind, sich auch vom geschrumpften Kuchen die größeren Stücke sichern werden.
Der Ruf nach einem Lohnstopp oder einem Lohn- und Preisstopp, dürfte schon bald laut werden. Die Wirkung wäre allerdings nicht anders als die Wirkung von Mietpreisdeckeln und -bremsen. Mietpreisregulierungen haben mit zum Erliegen des Wohnungsbaus beigetragen. Ein Lohn- und Preisstopp würde nur zum weiteren Schrumpfen des gesamten BIP beitragen.
Um da vernünftig wieder herauszukommen, bräuchten wir einen Wirtschaftsminister, der nicht nur „etwas“, sondern sehr viel von Wirtschaft versteht, einen Finanzminister, der nicht nur „etwas“, sondern sehr viel von dem versteht, was wir „Geld“ nennen, und einen Bundeskanzler, der seine Richtlinienkompetenz nutzt, um weiteren Schaden abzuwenden und den Nutzen des deutschen Volkes wieder zu mehren.
Solange solche Wünsche aber mit den linksgrünen Vorstellungen kollidieren und deshalb schon als Delegitimierung des Staates und seiner Repräsentanten angesehen werden und vermutlich auch als gesichert rechtsextrem gelten, wird daraus nichts werden.