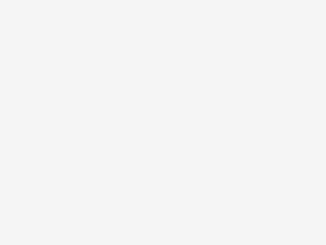PaD 14 /2019 vom 4. April 2019 – Hier auch als PDF: Pad 14 2019 Die Diskriminierungsfalle
Niemand darf wegen – x y z – benachteiligt werden.
Als noch Normalität herrschte, genügte die Aussage: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dieses Verbot, Menschen wegen bestimmter Merkmale ungleich zu behandeln, was immer auf eine Benachteiligung einer bestimmten Gruppe hinauslaufen würde, ist zunächst gegen den Staat und seine Organe gerichtet, der, vor allem wenn er demokratisch regiert wird, jedem seiner Bürger die gleichen Rechte gewähren und die gleichen Pflichten auferlegen muss.
Das Verbot der Ungleichbehandlung ist kein Verbot der Unterscheidung (gewesen), denn die Fähigkeit zur Unterscheidung und zur dementsprechenden unterschiedlichen Benennung ist eine Anforderung des Verstandes, ohne die ein Mensch niemals zu vernünftigen Erkenntnissen oder Entscheidungen gelangen könnte.
Es ist schlicht notwendig, zwischen einer Herbstzeitlosen und einem Krokus unterscheiden zu können, denn die Herbstzeitlose ist giftig, der Krokus, der ihr zum Verwechseln ähnlich sieht, ist es nicht.
Es ist ebenso notwendig, zwischen einem mehrfach vorbestraften Gewalttäter und einem bis dahin unbescholtenen Bürger zu unterscheiden. Der Gewalttäter neigt eben zur Gewalttätigkeit, der Unbescholtene offenbar nicht.
Von daher führen durchaus sinnvolle Unterscheidungen auch zu durchaus sinnvollen Benachteiligungen. Der mehrfach vorbestrafte Gewalttäter wird, wenn er sich wieder einer schweren Körperverletzung schuldig macht, zu einer Haftstrafe verurteilt werden, die er auch anzutreten hat, der bis dahin Unbescholtene kann damit rechnen, dass seine Strafe für eine gleich schwere Tat noch auf Bewährung ausgesetzt wird.
Wird hier der mehrfach vorbestrafte Gewalttäter benachteiligt? Wird er diskriminiert? Sicherlich nicht. Die Regeln sind für alle gleich. Auch der Mehrfachtäter kam beim ersten Mal mit einer Bewährungsstrafe davon.
Der Staat benachteiligt also nicht, weil er nicht die Taten vergleicht, dann müssten alle Körperverletzungen entweder mit Bewährungstrafen oder mit Strafen ohne Bewährung geahndet werden, sondern er benachteiligt nicht, weil er die Täter und deren Vorgeschichte vergleicht.
Ähnliches finden wir im Bereich des Arbeitsschutzes. Hier gilt eine Richtlinie, die besagt, dass Frauen (ohne geeignete Schutzmaßnahmen) nur weniger schwer heben dürfen als Männer. Ganz konkret:
Im Altersbereich von 19 bis 45 Jahren dürfen Frauen Lasten von bis zu 15 kg, Männer Lasten von bis 55 kg heben, wenn das weniger als zweimal je Stunde erforderlich ist und die Last nur 3 bis 4 Schritte weit getragen werden muss.
Im Arbeitsschutz stellt man also auch nicht auf die Last oder die damit verbundene Leistung ab, sondern auf die spezifischen körperlichen Fähigkeiten „durchschnittlicher“ Frauen und „durchschnittlicher“ Männer.
Werden hier die Männer benachteiligt, die Frauen bevorzugt, oder gar die Frauen diskriminiert? Sicherlich nicht. Es wird eine, im Sinne des Gesundheitsschutzes notwendige Unterscheidung zwischen Männern und Frauen getroffen, die auf wissenschaftlichen Untersuchungen der unterschiedlichen Belastbarkeit der beiden Geschlechter beruht. Auch hier werden im Grunde alle Menschen gleich behandelt. Wieder kommt es nicht auf „die Tat“ an, sondern auf die speziellen Besonderheiten die hier jedoch nicht, wie beim Straftäter, auf den Einzelnen bezogen sind, sondern auf wohldefinierte, unterscheidbare Gruppen.
Die drei vorangestellten Beispiele, Herbstzeitlose/Krokus, Mehrfachstraftäter/Ersttäter und hebende Frauen / hebende Männer haben sich als das sinnvolle Ergebnis zweckmäßiger Unterscheidungen herausgestellt, mit denen die Gleichheit aller vor dem Gesetz eben NICHT ausgehebelt wird. Weil dabei eben nicht auf die „gleichen Umstände“ (Krokus gleicht Herbstzeitlose, schwere Körperverletzung gleicht schwerer Körperverletzung, Last gleicht Last) eingegangen wird, sondern auf die relevanten Unterschiede (giftig/ungiftig, vorbestraft/unbescholten, männlicher Körperbau/weiblicher Körperbau).
Mit der Weiterentwicklung der Anti-Diskriminierungsgesetze, die inzwischen nicht mehr auf das Verhältnis von Staat/Gesetz gegenüber den Bürgern beschränkt sind, sondern weit in die privaten Gestaltungsfreiräume der Bürger untereinander hineinreichen, wurde dieses Prinzip zwar noch nicht umgekehrt, jedoch wurde der Boden bereitet für die linksgrüne Ideologie, in welcher „die gleichen Umstände“ absoluten Vorrang vor den bis zur Unkenntlichkeit verleugneten „relevanten Unterschieden“ erlangt haben. Es ist gelungen, den gesunden Grundgedanken bis zur Unkenntlichkeit zu überdehnen und eine auf Ausnahmslosigkeit zustrebende Ununterscheidbarkeit zu postulieren, in welcher schon die Benennung offenkundiger Unterschiede als Diskriminierung kriminalisiert wird.
Die Ursache liegt darin, dass die Gesellschaft dazu ermuntert wurde, nicht etwa wahre Diskriminierung, so sie denn auftritt, zu erkennen und abzustellen, sondern vermeintlich diskriminierten Personen oder Gruppen von Personen Vorteile zu gewähren, und sei es nur dadurch, dass man zugelassen hat, dass sie ihren ebenso törichten wie egoistischen Willen gegen die mehr oder minder schweigende Mehrheit – und das oft noch auf deren Kosten – durchsetzen.
Das Mirakel, beziehungsweise der Irrsinn, wird grundsätzlich dadurch hergestellt, dass die Besonderheit, also das Unterscheidungsmerkmal, erst ganz betont herausgestellt wird, um dann mit einer 180 Grad Kehrtwende darauf zu bestehen, dass diese Unterscheidung keinesfalls von anderen benannt oder gar argumentativ benutzt werden dürfe.
Ich bin zwar total anders als du,
aber ich unterscheide mich nicht von dir!
Diese Aussage ist eine zweifache Selbstbeschreibung. Sie erkennt die eigene Andersartigkeit einerseits an, ernennt sich aber dennoch mit dem erklärten Unwillen, sich zu unterscheiden, zum Gleichen unter Gleichen und fordert von der Umgebung den als notwendig empfundenen „Ausgleich“ der Unterscheidbarkeit durch Toleranz, Akzeptanz, Förderung und Wunscherfüllung. Dies trägt einen leicht zu übersehenden parasitären Zug in sich, wie er in anderem Zusammenhang schon länger als „Mitleidsmasche“ bekannt ist.
Das Vergleichsverbot
Zu den beliebten Versuchen, Unterschiede totzuschweigen, gehört das moralisch hergeleitete Vergleichsverbot. In seiner krassesten Form heißt es:
Man kann Tote doch nicht gegeneinander aufrechnen.
Wer die hohen Zahlen der Gefallenen und Verwundeten, die ein militärisch hochgerüsteten Staat verursacht hat, mit den geringeren Zahlen der Gefallenen und Verwundeten vergleicht, die von dessen „Feinden“ verursacht wurden, wird genau diesen Satz zu hören bekommen. Der Starke macht sich dem Schwachen gleich, um seine größere Schuld, oft auch sein größeres (Kriegs-)Verbrechen, hinter der Theorie des „unendlichen“ Leides zu verbergen, denn „unendlich“ lässt sich weder multiplizieren noch addieren oder subtrahieren. Folglich ist das unendliche Leid, das aus dem Tod eines Einzelnen herrührt, dem unendlichen Leid, das aus dem Tod von Tausenden herrührt, exakt gleich, und, so es eine „Schuld“ geben sollte, dann ist auch die exakt gleich.
Die Steigerung, ja, die gibt es noch, besteht dann darin, zu erklären, mit dem unzulässigen Vergleich werde das Andenken der Opfer der eigenen Gruppe in den Schmutz gezogen.
Ebenso gibt es ein Vergleichsverbot im Hinblick auf unterschiedliche Religionen. Aus der Tatsache der grundgesetzlich festgeschriebenen Religionsfreiheit wird hergeleitet, dass alle Religionen eben Religionen seien, und folglich gleich zu behandeln seien, auch wenn ihre Anhänger bzw. Gläubigen, die augenfälligsten Unterschiede und Andersartigkeiten, die in einem objektiven Vergleich krass zum Vorschein kämen, bei jeder Gelegenheit laut und aggressiv vertreten. Das geht so weit, dass religiöse Gebräuche, die eigentlich nach dem profanen Recht strafrechtlich verfolgt werden müssen, weil es ja „Religion“ ist, geduldet und gefördert werden. Schließlich wäre es ja Diskriminierung wegen der Religion, würde es dem Moslem verwehrt, seine Zweit- und Drittfrau, samt Kindern im Rahmen des Familiennachzugs ins deutsche Sozialsystem zu holen und das zu praktizieren, was seinem deutschen Nachbarn, der mit seinen Steuern zum Unterhalt der Großfamilie beiträgt, nach §172 StGB als Bigamie ausgelegt und ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren einbringen würde.
Im Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Stellenbewerbern ist das Vergleichsverbot gesetzlich vorgeschrieben. Verglichen werden nur die für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe erforderlichen Voraussetzungen, nicht aber alle übrigen in der jeweiligen Person erkennbaren Unterschiede. Stellenangebote müssen geschlechtsneutral gehalten werden, und wenn der Bewerber gegenüber einer Bewerberin vorgezogen wird, oder umgekehrt, wenn der Inländer den Job bekommt und der Ausländer eine Absage, muss der Arbeitgeber ggfs. vor Gericht nachweisen, dass bei der Auswahl ausschließlich die beruflichen Fähigkeiten eine Rolle spielten. Zwischenmenschliches muss draußen bleiben. Selbst wenn der Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch den Eindruck gewonnen haben sollte, der abgelehnte Bewerber passe von seiner Art, vom Auftreten, von seinen Einstellungen her nicht ins Team, wird er es schwer haben, hier beweiskräftige Angaben machen zu können. Das Ziel derartiger juristischer Auseinandersetzung kann jedoch nicht sein, den Arbeitsplatz doch noch zu erhalten, denn der ist ja schon vergeben, sondern ausschließlich eine Entschädigung, ein Schmerzensgeld wegen Diskriminierung und für die klammheimliche Freude des Klägers eventuell noch eine Geldstrafe für den wegen Diskriminierung verklagten Arbeitgeber.
Das Benennungsverbot
Ist auch heute noch ganz selbstverständlich ein Maurer ein Maurer und ein Steuerberater ein Steuerberater, statt von Menschen mit Maurerfähigkeiten oder mit Steuerberatungskenntnissen zu sprechen, gilt dies für Behinderte nicht. Behinderte sind als „Menschen mit Behinderung“ anzusprechen, weil kluge Denker auf den Gedanken gekommen sind, Behinderte könnten sich durch die Benennung als Behinderte auf ihre Behinderung reduziert und daher diskriminiert fühlen. Von daher heißen die Olympiaden der Behinderten Paralympics und die Teilnehmer sind nun nicht mehr Menschen, sondern „Sportler“ mit Behinderung. Der Logik folgend, müsste die Reduktion eines Menschen auf den „Sportler“ ebenfalls diskriminierend sein, doch diese Logik greift an dieser Stelle nicht mehr, vielleicht aber auch noch nicht.
Dass es einst Worte gab, die sehr präzise zum Ausdruck brachten, was heute mit „stark pigmentierte Menschen“ mühsam umschrieben werden muss, oder, geläufiger und noch breiter streuend: mit „südländischem Aussehen“, ist fast vergessen. Der Negerkönig ist aus Pippi Langstrumpf ebenso verschwunden, wie die Zehn kleinen Negerlein aus dem Liederbuch. Reihenweise werden „Mohrenapotheken“ umbenannt, und selbst der „Sarotti Mohr“ ist einen stillen Tod gestorben.
Dass diejenigen, die Neger diskriminieren wollen, dies auch weiter tun, wenn ihnen ein Neger die Gelegenheit dazu bietet, spielt dabei ebenso wenig eine Rolle, wie es keine Rolle spielt, dass „Neger“ hierzulande ein ganz normales unschuldiges Wort war, bis die Jäger der verborgenen Diskriminierung dieses Wort auf den Index setzten.
So richtig verrückt wurde die Angelegenheit allerdings erst, als sich das Verbot geschlechtsspezifischer Benennungen, erst mit den angehängten -Innen, später mit dem Gender-Sternchen und letztendlich mit der Verballhornung der Sprache durchsetzte. Seitdem gibt es keine Radfahrer mehr, sondern nur noch Radfahrende, keine Lehrer, sondern Lehrende, und selbst wo der Professor als geschlechtsneutrale Bezeichnung hätte genügen können, musste die „Professorin“ zur Norm erklärt werden, mit dem aberwitzigen Ergebnis, dass es nun sowohl die Frau als auch den Herrn Professorin zu geben hat.
Die Weiterung folgte mit dem „dritten Geschlecht“ auf dem Fuße. Ein „Konstrukt“, das weit mehr von allen möglichen sexuell Desorientierten in Anspruch genommen wird als von den glücklicherweise wenigen, aber wirklich unglücklichen echten Intersexuellen. Und wo es ein drittes Geschlecht gibt, sorgt der preußische Beamte auch dafür, dass es die dritte Toilette gibt. Wegen der Diskriminierung.
Mobbing
Die viel beklagte Zunahme des Mobbings hat nach meiner Einschätzung sehr viel damit zu tun, dass „Andersartigkeit“ heute wie ein Heiligenschein getragen wird und mit dem Anspruch daherkommt, alle anderen hätten sich anzupassen.
Wer sich als Veganer hervortut, nicht aufhört, den Fleischgenießern ihre Sünden vorzuhalten und jeden Mittag in der Kantine für Stress sorgt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er auf Ablehnung stößt. Manch einer fühlt sich ja schon gemobbt, wenn er in der Kantine alleine am Tisch sitzen muss. Aber es sind ja nicht nur die Veganer. Die Zahl der Menschen, die einfach nur „nerven“, weil sie sich ganz betont von den anderen unterscheiden, aber zugleich mit ihrer „Besonderheit“ vollständig akzeptiert werden wollen, wächst. Vermutlich hat das viel mit den Erziehungsidealen der Ein-Kind-Familie zu tun, die dazu anhalten, jedes Verhalten zu loben, und sei es noch so dämlich, und jeder egoistischen Regung unverzüglich nachzugeben. Noch ein paar Jahre, und die Gesellschaft könnte soweit ausdifferenziert sein, dass es ein Wunder ist, wenn sich noch zwei finden, die mit den gleichen Interessen, gleichen Werten und gleichen Wünschen eine Weile beieinander sein können, ohne in Streit zu geraten.
Vollkommen anlassloses Mobbing gibt es in einer halbwegs gesunden Gesellschaft nicht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, Mobbing auszulösen. Überheblichkeit und Arroganz, Protzen und Prahlen gehören dabei ganz vorne mit dazu, auch Angeberei, Lügen und Verleumden, der Verrat von Geheimnissen, Denunziation, das alles kann auch unter sehr zivilisierten Zeitgenossen den Wunsch auslösen, eine Grenze zu ziehen und den Umgang mit dem Betreffenden auf das Nötigste zu beschränken und die Missbilligung oder Verachtung auf mannigfache Weise zum Ausdruck zu bringen.
Mobbing wegen körperlicher Gebrechen oder geistiger Einschränkungen findet sich in der Regel nur unter Primitiven, die sich so auf der gesellschaftlichen Hierarchieleiter selbst eine Stufe höher ansiedeln wollen, als jene, auf die sie wegen offenkundiger Einschränkungen herabschauen können. Dieses Mobbing, das ich als Gewohnheit im „Bodensatz der schlechten Gesellschaft“ bezeichnen möchte, gab es schon immer – und wird es immer geben. Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.
Wer jedoch merkt, dass er mit seinem Verhalten in einer Gruppe, sei es am Arbeitsplatz, im Verein, in der Schule, nicht gut ankommt, der sollte sein Verhalten oder seine Ansprüche an das Verhalten der anderen ändern, wenn er dazugehören will. Wer sich als den Nabel der Welt begreift, wird solange gemobbt werden, bis er dieses Selbstbild korrigiert hat.
Die Diskriminierungsfalle
Der Titel dieses Aufsatzes weist darauf hin, dass der „Diskriminierungs-Rausch“, in dem sich unsere Gesellschaft bereits befindet, wie jeder Rausch eine durchaus schädliche Wirkung auf das Wahrnehmungs-, Urteils- und Reaktionsvermögen hat.
Die alte, sinnvolle und nützliche Regel, dass für die Gleichbehandlung nicht der „Sachverhalt“ alleine entscheidend sein darf, sondern dass primär die individuellen, persönlichen Wesens-Merkmale entscheiden, ob die allgemeinen Regeln durch spezielle, angepasste Regeln ergänzt werden müssen, wurde von den Füßen auf den Kopf gestellt.
Ein herausragendes Beispiel ist der Schützenpanzer PUMA der Bundeswehr. Das von Kraus-Maffey-Wegmann für den Kriegseinsatz produzierte Gerät ist etwas zu eng geraten. Nicht wirklich. Nur für den einen, ganz speziellen Sonderfall. Schwangere Soldatinnen passen nämlich nicht richtig hinein, es bestünde die Gefahr einer Fruchtwasserschädigung. Die zur Abwendung der Diskriminierung schwangerer Soldaten durchgesetzte Anpassung des leichten Panzerfahrzeugs brachte eine Verzögerung der Auslieferung an die Truppe um mehrere Jahre mit sich, eine Kostensteigerung sicherlich ebenfalls.
Abgesehen davon, dass es heißt, die Amazonen hätten sich seinerzeit eine Brust amputieren lassen, um besser mit dem Bogen schießen zu können, sind Frauen nicht unbedingt das, was ich mir als Ideal der Frontkämpfer der Bundeswehr vorstelle. Doch wenn eine Frau den Soldatenberuf ergreift, und sich dabei nicht auf das Sanitätswesen beschränken will, dann soll sie es meinetwegen tun, falls sie die Anforderungen, die der Beruf mit sich bringt erfüllt. Ist die Soldatin aber schwanger und trägt die neue Umstandsuniform und den Umstandskampfanzug der Bundeswehr, dann soll sie gefälligst nicht auch noch Panzer fahren wollen.
Früher hieß es in Gefahrensituationen: „Frauen und Kinder zuerst!“ Also runter vom sinkenden Schiff und rein in die Boote.
Heute soll die Soldatin offenbar bis zum Beginn des Mutterschaftsurlaubs im achten Schwangerschaftsmonat vollwertigen Dienst an der Waffe tun und bekommt sogar noch einen Platz im eigens konstruierten Schwangerenpanzer.
Die Diskriminierungsfalle hat zugeschlagen. Frauen dürfen nicht diskriminiert werden, also dürfen sie Soldat sein, Schwangere dürfen wieder nicht diskriminiert werden, also müssen sie sich auch mit dickem Bauch in den Stahlsarg klemmen dürfen, und wenn das Verteidigungsministerium das nicht möglich macht, dann gibt’s den vollen Diskriminierungsstress.
Sicherlich gilt aber auch bei der Bundeswehr der Mutterschutz. Die Schwangere darf nicht so beschäftigt werden, wie der Krieg es verlangt, sondern nur in dem Umfang, in dem das Mutterschutzgesetz es erlaubt.
Es wäre leichter und sinnvoller, Schwangeren ab dem vierten Schwangerschaftsmonat den Dienst an der Waffe zu verbieten, eben weil sie schwanger sind, also die persönlichen Voraussetzung für eine spezielle Regel mitbringen, statt solche teuren Klimmzüge zu veranstalten.
Ich will hier nicht mit der Aufzählung weiterer Beispiele langweilen, sondern auf die eigentliche Gefahr hinweisen, die der Diskriminierungsrausch für unsere Gesellschaft insgesamt darstellt.
Wie wirkt sich das Paradoxon aus, das mit dem Antidiskriminierungskrieg in die Welt gesetzt wurde? Was macht diese Überzeugung mit einer Gesellschaft, was macht sie mit unserem Gehirn?
Ich bin zwar total anders als du,
aber ich unterscheide mich nicht von dir!
Der Mensch, der gewohnt ist, Entscheidungen zu treffen, indem er zwischen möglichen Varianten oder Alternativen wählt, wird seine Entscheidung umso besser treffen können, je präziser er zwischen den Varianten und Alternativen unterscheiden und die festgestellten Unterschiede auch bewerten kann.
Die Antidiskriminierungsregeln erziehen dazu, die Unterschiede zwar wahrzunehmen, ja sogar überhöht und vergrößert, doch gleichzeitig verbieten sie die Bewertung dieser Unterschiede. Dies ist ein massiver Eingriff in den Verstand, der sich nicht so einfach eingrenzen lässt. Ein Gehirn, das in einem Themenbereich so trainiert wird, wird immer versuchen, das erfolgreich Erlernte auch auf anderen Gebieten anzuwenden. Die Gefahr liegt dabei darin, dass die negativen Folgen von Fehlentscheidungen aufgrund fehlender Urteilsfähigkeit ebenso wenig wahrgenommen werden, wie das Problem der Unfähigkeit, Sachverhalte und Unterschiede richtig zu bewerten.
Die eigenen Ergebnisse bestimmter Vorhaben werden sich womöglich von den Ergebnissen anderer unterscheiden lassen, aber außer in Extremsituationen, werden diese Unterschiede nicht mehr bewertet. Es ist gut so, wie es geworden ist, auch wenn es anders geworden ist. Dass es schlecht geworden ist, wird niemand mehr zu sagen wagen. Es sei denn, er wollte sich der Diskriminierung schuldig machen.
Das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare weist bereist deutlich in diese Richtung. Wahrgenommen und meist prononciert verkündet wird: „Wir sind schwul, bzw. lesbisch.“ Die Unterscheidung endet da aber. Die Idee, dass schwule oder lesbische Paare keine Kinder zeugen können, ja nicht einmal welche zeugen wollen, kommt nicht mehr auf den Schirm.
„Wer uns das Kind verwehrt, diskriminiert uns“, heißt es dann, und die Politik, der offenbar ebenfalls die Bewertungsmaßstäbe abhandengekommen sind, gibt nach. Auch und vor allem, weil das „Geschlecht“ ja inzwischen nicht mehr als biologisches und psychologisches, entwicklungsgeschichtlich ausgeprägtes Merkmal zum Zwecke der bestmöglichen Arterhaltung anerkannt wird, sondern lediglich noch als ein ganz und gar oberflächliches soziales Konstrukt, dessen Ausprägung völlig egal ist.
Ein anderes Beispiel ist die so genannte Inklusion. Gar nichts dagegen einzuwenden, wenn in einer Schulklasse von 20 oder 25 Schülern zwei oder drei mit körperlicher Behinderung sitzen. Wenn auch die Lehrkraft entsprechend geschult ist, wird sich höchstwahrscheinlich eine gute Klassengemeinschaft herausbilden, die den Behinderten hilft, die Lernziele zu erreichen und den nicht Behinderten hilft, Behinderte, mit ihren Einschränkungen anzunehmen, also da, wo die Behinderung behindert, darauf Rücksicht zu nehmen, bzw. unterstützend einzugreifen.
Gleiches gilt, wenn auch mit erhöhten Anforderung an die Lehrkraft und ihre didaktischen Fähigkeiten, wenn in einer Schulklasse zwei oder drei sitzen, die nur über rudimentäre Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen.
Die Realität sieht leider anders aus. Die Unterschiede zwischen körperlich
Behinderten und geistig Behinderten, zwischen Schülern, die dem Unterricht auf Deutsch folgen können, und solchen, die dazu nicht in der Lage sind, zwischen Schülern mit Aufmerksamkeitsdefiziten und solchen die auch länger als drei Minuten konzentriert arbeiten können, werden zwar betont, doch nicht bewertend berücksichtigt. Schüler mit und ohne Behinderung, mit und ohne Deutschkenntnisse, mit und ohne Aufmerksamkeitsdefizit werden gleich behandelt und das Rezept als diskriminierungsfreie „Inklusion“ gelobt, bis hin eben zu Klassen, die aufgrund der verheerenden Zusammensetzung der Schüler nicht mehr zulassen, dass mehr als zwei oder drei hochmotivierte Schüler ohne Handicap die Lernziele erreichen.
Der Verzicht auf Noten, und wo noch nicht auf Noten verzichtet wird, die Verschiebung der Notenskala mit dem Ziel, die Lernziele als erreicht erscheinen zu lassen, sind die logische Folge, zumal ja auch jede Benotung im Prinzip eine für das ganze Leben schädliche Diskriminierung darstellt.
Der Sinn von Schulnoten, nämlich Unterschiede deutlich zu machen und zu bewerten, auch um aufzuzeigen, wo der Schüler noch arbeiten muss, um den Anschluss an die Klasse nicht zu verlieren, wird nicht mehr begriffen, sondern in eine absurde Theorie umgemünzt, es ginge mit der Benotung nur darum, eine (wieder diskriminierende) frühe Auslese zu vollziehen, den Siegern den Weg zum Studium freizumachen und alle anderen auf Hauptschulniveau hängen zu lassen.
Wir sind auf dem Weg, das Urteilsvermögen abzuschalten, schon weit vorangekommen. Und weil wir schon so weit vorangekommen sind, sind wir gar nicht mehr in der Lage, die Überraschung am Ende des Weges zu erkennen.
Am Ende des Weges lauert eine Gesellschaft, in der die große Masse der Bevölkerung aus den Erträgen der Wirtschaft mit einem für alle gleichen Grundeinkommen versorgt wird. Schließlich kommt es nicht darauf an, was einer tut, und wie gut er es tut, sondern dass er etwas tut. Was ist egal. Hier zu unterscheiden zwischen einem Chirurgen und einem Polizisten, zwischen einem Lehrer und einer Sexarbeiterin wäre doch nur Diskriminierung pur.
Zur Wahl stünde nur noch eine Partei, die sich in unseren Tagen gerade herausbildet, und dabei ist alles andere zu verdrängen, nämlich der Zusammenschluss von CDU, CSU, SPD, FDP, und Grünen. Die Mitgliedschaft in dieser Partei ist erwünscht, wer sich ausschließt, diskriminiert alle, die dort engagiert sind.
Die LINKE und die AfD werden sich entweder freiwillig auflösen und sich, wenn sie es mit der politischen Arbeit ernstnehmen, der Einheitspartei anschließen und sich dort einbringen. Lösen sie sich nicht freiwillig auf, werden sie vom Verfassungsgericht verboten, weil sie mit ihren Programmen und Forderungen fortwährend gegen die diskriminierungsfreie Grundordnung verstoßen.
Die Grenzen bleiben offen, weil Deutschland endgültig niemanden mehr wegen seiner Herkunft diskriminiert. Die Einbürgerung erfolgt über einen Kassenautomaten in den Rathäusern, der – gekoppelt mit einem Fotoautomaten und einem Fingerabdruckscanner – gegen eine Gebühr von 45 Euro Personalausweis und Reisepass ausspuckt. Die Gebühr wird, soweit Bedürftigkeit angegeben wird, vom JobCenter in Form eines Gutscheines erstattet, der an der Kasse bei REWE eingelöst werden kann.
Im Radio wird keine Musik mehr gesendet, weil nicht genügend Sendezeit vorhanden ist, um alle Gruppen und Interpreten zu Gehör bringen zu können. Eine Vorauswahl durch die Sender würde alle nicht gesendeten diskriminieren. Es genügt daher ein Einheitssender, über den ausschließlich Nachrichten verbreitet werden. Gleiches gilt für das Fernsehen. Nur noch ein Programm. Keine Spielfilme, keine Serien, kein Quiz, keine Talkshow, denn überall würden sich die nicht Berücksichtigten zu Recht diskriminiert fühlen müssen.
Fußballspiele wird es noch geben, jedoch nur noch eine einzige Neue Bundesliga in der alle 26.000 Vereine vereinigt sind. Die Paarungen werden wöchentlich ausgelost. Auf den Plätzen werden keine Tore mehr aufgestellt, so dass endlich der Sport, der Umgang mit dem Ball, im Vordergrund stehen, und diskriminierende Siege und Niederlagen, bis auf das von vornherein feststehende, diskriminierungsfreie 0 : 0 unentschieden am Ende eines jeden Spieles verkündet werden wird.
Ja, für den Schluss gilt: Übertreibung macht anschaulich.
Aber: Wie weit sind wir denn schon gekommen? Wo sehen Sie denn das Ende dieser Fahnenstange, die eher wie ein babylonischer Turm in den Himmel ragt, wobei die Sprachverwirrung bereits eingesetzt hat.
An der Spitze unseres Staates stehen zu viele Personen, die vorher weder eine fachliche Qualifizierung für ihr Ressort durchlaufen haben, noch jemals für längere Zeit außerhalb des Politikbetriebes beschäftigt waren.
Personen, die einen Erfolg darin sehen, mit billiger Propaganda möglichst viele Wählerstimmen auf sich und ihre Partei zu ziehen, aber keinen Plan haben, für dieses Land. Personen, die sich darauf verlassen, dass ihre Urteilsschwäche und die daraus folgenden Inkonsequenzen im Handeln im großen Topf der EU nicht mehr erkennbar sein werden, ja dass eines Tages, eines Tages, den sie herbeisehnen, die Verantwortung von ihren Schultern genommen und vollends dem Brüsseler Kommissariat übertragen wird.
Wir sind, wie eine Herde Rinder, in einen Trichter getrieben worden, an dessen engem Ausgang der Viehtransporter zum Schlachthof bereitsteht. Die weit genug vorne angekommen sind, haben keine Chance zur Umkehr, weil die eigene Herde den Rückweg versperrt.
Daher müssen wir den Zaun der political correctness – vom einen Ende des Trichters bis zum anderen – nicht nur überwinden, sondern niederreißen. Die Herde ist stark genug dafür, und wo ein Anfang gemacht ist, folgen alle anderen nach.
Das Rezept: Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und in die eigene Urteilskraft.
Sagen Sie, was Sie sehen: „Der Kaiser ist nackt!“
Und denen, die das nicht wahrhaben wollen, können Sie den Unterschied zwischen einem Nackten und einem korrekt bekleideten Menschen ganz einfach vor Augen führen.
Sie sind korrekt bekleidet!
Wie peinlich sieht der Kaiser dagegen aus!