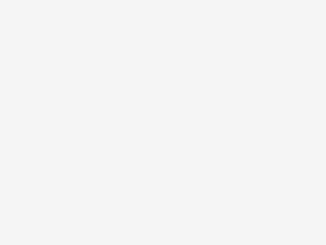PaD 42 /2023 – Hier auch als PDF verfügbar: Pad 42 2023 Irrsinn mit Methode – Infrastruktur, Glasfaser
In der Unternehmensorganisation spricht man von Querschnittsfunktionen, wenn bestimmte Leistungen in speziellen Einheiten für das gesamte Unternehmen erbracht werden.
Ein klassisches Beispiel ist die zentrale Einkaufsabteilung.
Die Einkaufsabteilung beschafft alles, was von allen Gliederungen des Unternehmens benötigt wird. Dort sitzen Mitarbeiter mit ausgezeichneter Marktkenntnis, jeder einzelne davon spezialisiert auf bestimmte Arten von Produkten. Ob es um hunderte Tonnen von Stahl für die Fertigung, um die Leasing-Fahrzeuge für die Außendienstmitarbeiter oder um den Vertrag mit der Reinigungsfirma geht, ist „der Einkauf“ gefragt, aber auch die Druckaufträge für allerlei Formulare und der Auftrag zur Auffüllung des Getränkevorrats im Vorstandsweinkeller werden hier vergeben. Die Einkaufsabteilung wird je nach Beschaffungsauftrag entweder Rahmenverträge vereinbaren, aus denen Bedarfsmengen abgerufen werden können, oder eben auch die Einzelbestellung für den Christbaum abwickeln, der in der Adventszeit das Foyer im Verwaltungsgebäude schmücken soll. Die vielen Vorteile, die sich aus einer solchen Organisation ergeben, würden ausreichen, ein betriebswirtschaftliches Seminar zu bestreiten. Hier soll nur festgehalten werden, dass solche Querschnittsfunktionen – von wenigen, begründbaren Ausnahmen abgesehen – einen großen Nutzen für das Unternehmen erwirtschaften.
Ein zweites Beispiel von Querschnittsfunktionen soll von der Struktur der Abläufe, die bei Bedarf relativ leicht revidiert werden kann, zu physikalischen Strukturen überleiten, die – einmal geschaffen – nur mit ganz erheblichem Aufwand grundsätzlich verändert werden können. Nehmen wir das Heizkraftwerk im großen Fertigungsunternehmen. Hier wird Prozesswärme, Heizwärme und Strom erzeugt und über die notwendigen Leitungen verteilt. Zur Errichtung dieser Infrastruktur sind mehrstellige Millionenbeträge an Investitionsmitteln aufgebracht worden, die sich über die Jahre aus der Differenz zwischen den Kosten für den Fremdbezug oder den Kosten einer dezentralen eigenen Struktur der Wärmeerzeugung, und den Betriebskosten des zentralen Heizkraftwerks amortisieren sollen. Auch hier soll nicht auf die – teils tückischen – Details eingegangen werden. Es genügt, dass eine fundierte Investitionsentscheidung in der Regel über viele Jahre deutliche wirtschaftliche Vorteile versprechen wird.
Im – nicht exakt definierten – Zuständigkeitsbereich des Staates und seiner Gliederungen ist es vor allem die Infrastruktur der Grundversorgung, die als Gemeinschaftsaufgabe erkannt und wahrgenommen werden sollte. Hier haben sich in früheren Zeiten Staatsmonopole und vom Staat geschützte, privatwirtschaftliche Monopole herausgebildet, die sowohl auf kommunaler, als auch auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene etabliert wurden. Es gab einst, auf der untersten Gliederungsstufe, die Kehrbezirke der Schornsteinfeger, die den Charakter regionaler Monopole hatten, und auf der Ebene des Bundes das Post- und Fernmeldemonopol, angesiedelt beim Staatsunternehmen „Deutsche Bundespost“. Es gab in der Elektrizitätsversorgung Gebietsmonopole, bei denen Erzeugung und Verteilung in einer Hand lagen, es gab den Monopolbetrieb der Deutschen Bundesbahn, die sowohl das Streckennetz als auch den Fahrbetrieb in einer Hand vereinigte. Von alledem ist nichts mehr geblieben.
Die Bahn, noch zu hundert Prozent im vom Staat gehaltenen Volkseigentum, muss sich ihr Schienennetz mit privaten Bahnunternehmen teilen, wobei die Bundesländer für den Betrieb des Regionalverkehrs auf ihrem Gebiet regelmäßig Ausschreibungen zu veranstalten haben. Die daraus entstehenden Mehrkosten sind erheblich, denn das Unternehmen, das heute die Ausschreibung gewonnen hat, muss damit rechnen, bei der nächsten Ausschreibung zu verlieren und auch anderswo so schnell keinen Anschlussauftrag zu erhalten, so dass der gesamte Aufwand, der mit der Bewerbung und mit allen Investitionen, die zur Aufnahme des Betriebs zu erbringen ist, innerhalb der Laufzeit des Vertrages amortisiert werden muss. Um dennoch einen Gewinn erwarten zu können, müssen Wartung und Instandhaltung auf ein Mindestmaß eingedampft werden, müssen die Arbeitsbedingungen und die Löhne der Beschäftigten in die Nähe der gesetzlichen Mindestvorgaben bewegt und der Service für die Bahnkunden, da, wo er personalintensiv ist, abgebaut werden, soweit es irgend geht.
Es ist hier ein – nach meiner Einschätzung vollkommen unsinniger – Wettbewerb ermöglicht worden, der allerdings voll im Trend der so genannten „Privatisierungs-Initiative“ liegt, mit der dem Kapital der Zugang zur Infrastruktur der Grundversorgung geöffnet wurde, also Gewinnmöglichkeiten für Privatunternehmen eröffnet wurden, wo vorher – nicht immer optimal bewirtschaftet – der Staat ohne Gewinnabsicht für die Bedarfsdeckung sorgte.
Noch krasser sind die Folgen der Privatisierung da zu beobachten, wo große Wohnungsbestände aus Bundes-, Landes- und kommunalem Eigentum an Investoren mehr oder minder „verschleudert“ wurden, was die Situation auf dem Wohnungsmarkt keineswegs verbessert hat, und da, wo sich die öffentlichen Träger von Krankenhäusern, Kliniken und Reha-Einrichtungen getrennt haben, was – man hätte es wissen können – im Verbund mit der Einführung von Fallpauschalen dazu führte, dass sich die privaten Einrichtungen als „Rosinenpicker“ betätigten, sich also auf die lukrativen Eingriffe – nicht spezialisierten, sondern – beschränkten, und den weiterhin bestehenden Häusern im öffentlichen Besitz die schlecht bezahlte Drecksarbeit überlassen haben. Das hat der Branche Milliardengewinne beschert – und beschert uns jetzt ein Kliniksterben durch Insolvenzen in einem nie gekannten Ausmaß. Schon sehen sich die ersten Landkreise gezwungen, die einst verscherbelten Häuser wieder in Eigenregie zu übernehmen und sie mit massiven Zuschüssen am Leben zu erhalten, was – wären sie gleich bei den ehemaligen Trägern geblieben – lange nicht solche Schockwellen ausgelöst hätte, wie sie heute verkraftet werden müssen.
Noch grotesker ist jedoch das, was sich heute auf dem Gebiet der Kommunikations-Infrastruktur abspielt.
Einst war es die Deutsche Post alleine, die Unternehmen und Haushalte, egal ob in der Innenstadt von Hamburg oder im hintersten Weiler im Bayerischen Wald, mit einem Telefon-Anschluss versorgte, wobei für alle Neukunden der gleiche Pauschalbetrag für die Bereitstellung des Anschlusses fällig wurde. Dies korrespondierte durchaus mit dem Grundgedanken der Gleichheit der Lebensbedingungen für alle Deutschen und es war deshalb politisch so gewollt, dass eben auch die Kosten für die drei Kilometer lange Leitung von der Ortsvermittlungsstelle bis zum Einöd-Bauern Hinterhuber, die für dessen Telefonanschluss eigens verlegt werden musste, von der Gemeinschaft, und nicht vom Bauern Hinterhuber getragen wurde.
Mit der Privatisierung der Post hat sich das verändert. Weder die Telekom, als Nachfolgerin der Post auf dem Telekommunikationssektor, noch die anderen Mitbewerber, die sich auf diesem Markt tummeln, sehen sich veranlasst, den Bauern Hinterhuber nach dem Stand der Technik mit einem Telekommunikations-Anschluss zu versorgen, wenn abzusehen ist, dass die Gebühren des Hinterhuber auch in tausend Jahren nicht jene Summe erreichen werden, die die Herstellung seines Anschlusses erfordert. So hängt er also weiterhin an dem Kupferkabel, das einst die Deutsche Post verlegt hat und muss froh sein, wenn der DSL-Ausbau in seiner Region wenigstens so weit fortgeschritten ist, dass er – bei der Leitungslänge – mit 6 MBit/s im Downstream wenigstens ein bisschen Internet zur Verfügung hat.
Der Stand des Breitbandausbaus in Deutschland ist, trotz aller Verheißungen, die mit der Privatisierung der Telekommunikation einhergingen, im weltweiten Vergleich nur erbärmlich zu nennen, und unglücklicherweise trifft das auf das Mobilfunknetz ebenso zu.
Den Klagen der Betroffenen, der vom Fortschritt Abgehängten und damit in vielen Branchen nicht mehr Wettbewerbsfähigen, wollte die Bundesregierung mit einer so genannten Gigabit-Strategie abhelfen, in der zwar hochgesteckte Ziele, aber eben nicht die zur sicheren Erreichung erforderlichen Maßnahmen beschrieben sind.
Nach wie vor gilt die für eine flächendeckende Versorgung tödliche Regel:
„Jedes Unternehmen darf Glasfaser dort verlegen, wo es sich wirtschaftlich zu rechnen scheint.“
Angefangen hat das zwar schon in den 90er Jahren, dass private Anbieter in den Großstädten eigene Glasfasernetze errichteten, ein Angebot, das vor allem an Großunternehmen und besondere Bedarfsträger gerichtet war, und für diese nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile brachte.
Für den privaten Endkunden galt jedoch immer noch, dass – ganz unabhängig vom gewählten Anbieter – die so genannte „dirty last mile“, der letzte Weg zum Anschluss des Teilnehmers, über jene Kupferkabel erfolgte, welche die Telekom von der Deutschen Post übernommen hatte.
Die Infrastruktur der Telekommunikationsversorgung war also, ebenso wie die Infrastruktur der Wasserver- und Abwasser-Entsorgung eine Sache, die einmalig, meist schon im Rahmen der Grunstückserschließung, hergestellt wurde.
Niemand kommt (hoffentlich!) auf die Idee, einen Wettbewerb im Bereich der Trinkwasserversorgung zu ermöglichen, so dass die bestehenden kommunalen, bzw. regionalen Wasserversorger in Konkurrenz zu privaten Anbietern treten müssen, die ihrerseits, jeder für sich, noch einmal eine Wasserleitung verlegen und Hausanschlüsse herstellen würden, so dass die Zahl der Wasseranschlüsse pro Grundstück mit jedem – von der Bundesnetzagentur zur Förderung des Wettbewerbs empfohlenen – Anbieterwechsel wachsen würde.
Beim Glasfaserausbau gilt aber exakt dieses Prinzip.
Ein Prinzip, das selbstverständlich geeignet ist, einerseits neue, regionale Monopole zu schaffen, wovon der Platzhirsch, die Telekom, den größten Nutzen haben wird, und andererseits die Unterschiede in der Versorgung zwischen Stadt und Land noch weiter zu vergrößern.
In städtischen Ballungsräumen können sich Investitionen mehrerer großer Anbieter immer noch rechnen, auch wenn jeder seine eigenen Glasfaserkabel verlegt, solange nur eine ausreichende Zahl von Kunden gewonnen werden kann.
In den ländlichen Regionen kann ein wirtschaftlicher Betrieb allenfalls für einen Anbieter gewährleistet sein, und auf dem ganz flachen Land wird sich im Zweifelsfall niemand finden, der sich einen solchen Klotz ans Bein binden will. Der Effekt: Irgendwer muss den Ausbau mit verlorenen Zuschüssen finanzieren, während in München, Frankfurt, Hamburg und Berlin die fetten Gewinne jener sprudeln, die sich zwischen Furth im Wald und Bodenmais nur mit massiven Subventionen zur Investition nötigen lassen.
Wo es also solche problematischen wirtschaftlichen Situationen gibt, wäre es ausgesprochen hilfreich, einem Unternehmen, das sich um den Ausbau bewirbt, im Gegenzug für die Erfüllung der Ausbauziele einen entsprechenden Gebietsschutz zuzusichern, ggfs. auch unter der Bedingung, Konkurrenten gegen entsprechende Gebühren, die Nutzung seiner Netzinfrastruktur zu öffnen, analog zur gemeinsamen Nutzung der letzten schmutzigen Meile beim Kupferkabel.
Dies ist mitnichten der Fall. Telekom-Konkurrenten stehen stattdessen einem anderen Phänomen gegenüber:
Immer dann, wenn sich ein Netzbetreiber entschlossen hat, ein bestimmtes Gebiet mit Glasfaser zu versorgen, ist damit zu rechnen, dass die Telekom mit gleichartigen Plänen auftritt und so dafür sorgt, dass die Wirtschaftlichkeit der Investition in Frage gestellt wird.
Die Telekom setzt darauf, Verluste in schwachen Regionen über eine gewisse Zeit mit den Gewinnen aus den Ballungsräumen kompensieren zu können. Weniger kapitalstarke Wettbewerber sind hingegen früher am Ende, und dann hat sich – unter erheblichen Verlusten für das aus dem Markt gedrängte Unternehmen und die Volkswirtschaft insgesamt – wieder ein regionales Monopol etabliert. Es ist also das Gegenteil dessen erreicht, was mit der Marktöffnung und dem Wettbewerb erreicht werden sollte,.
Das Handelsblatt hat – leider hinter der Bezahlschranke – darüber berichtet, „Wie die Telekom ihre Marktmacht beim Glasfaserausbau nutzt“, und darüber, dass die gemeinsam vorgetragene Beschwerde der Wettbewerber von Bundeskartellamt, Monopolkommission und der Bundesnetzagentur abgebügelt wurde.
So wird das nichts, mit der Gigabit-Strategie,
deren Zielsetzung Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, so beschreibt:
„Mit unserer Gigabitstrategie wollen wir den digitalen Aufbruch für Deutschland erreichen. Home-Office, Streaming im ICE und Empfang auf der Berghütte müssen endlich problemlos möglich sein. Dafür brauchen wir überall leistungsfähige digitale Infrastrukturen, das heißt Glasfaser bis ins Haus und den neusten Mobilfunkstandard.“
Wollen, müssen und brauchen – das sind noch keine Maßnahmen.
An Maßnahmen vorgesehen ist aber wieder nur das Übliche, alles, was nichts kostet und kaum etwas bringt. Spruchblasen, die wir auch von anderen Themenfeldern kennen und die als Maßnahmen verkauft werden, obwohl es nichts als Absichtserklärungen sind:
- Digitale und schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren
- häufigerer Einsatz alternativer Verlegetechniken beim Glasfaserausbau
- mehr Transparenz durch ein Gigabitgrundbuch
- Schließung weißer Flecken und bessere Mobilfunkversorgung an Bahnstrecken
- engere Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen und Marktteilnehmern.
Ach so, ja, ein Eingeständnis gibt es auch noch, wenn auch gut getarnt als Botschaft für jene, die des Lesens zwischen den Zeilen mächtig sind, dass nämlich der Staat die Unternehmen mit reichlich Subventionen da zum Jagen tragen muss, wo sie selbst keine Motivation dafür verspüren. Dazu heißt es von der Bundesregierung (hier):
„Der Ausbau der Netze in Deutschland ist jedoch eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Telekommunikationsbranche wird allein in den privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau 50 Milliarden Euro bis 2025 investieren. Für eine enge Kooperation zwischen den Unternehmen und dem Staat wird ein regelmäßiger Branchendialog geführt. Außerdem wird es neben den etablierten Gremien einen Bund-Länder-Ausschuss auf Staatssekretärsebene geben, der viermal im Jahr tagen soll.“
Anmerkung aus persönlichem Erleben:
Vor etwa 2 Jahren wurde in Elsendorf Glasfaser verlegt. Zu verdanken ist das wahrscheinlich der Ansiedlung von Magna International, die hier mit einer Kompanie von Robotern aus Blechteilen, die in Österreich gestanzt und gepresst werden, Autotüren für BMW und Audi zusammenschweißt. Ohne schnellstes Internet ist diese Fertigung nicht zu betreiben.
Nächstes Jahr im März wird 1&1 die Straßen wieder aufreißen und ein zweites Glasfaserkabel verlegen.
Endlich Wettbewerb? Ach, was freu ich mich!
Nein! Blödsinnige Doppelinvestition,
die letztlich über die Tarifgestaltung wieder hereingeholt werden muss, und zudem eine volkswirtschaftliche Verschwendung von Geld, Grips und materiellen Ressourcen, die aber im BIP als Wachstum ebenso gefeiert werden wird, wie die hochsubventionierte Investition in den neuen Hochofen des Salzgitter-Konzerns, der mit grünem Wasserstoff betrieben werden soll, obwohl grüner Wasserstoff in absehbarer Zeit weder in den benötigten Mengen, noch zu erträglichen Preisen bereitgestellt werden kann, zumal das erforderliche, versprödungssichere Leitungsnetz auch erst noch geplant und hergestellt werden müsste.