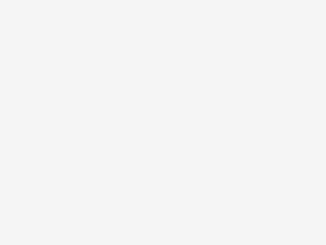Wozu braucht es in der Pandemie Föderalismus, Bundesländer, Ministerpräsidenten, wo es doch Angela Merkel gibt?
Das ist eine so schwer zu beantwortende Frage, dass sie den Rahmen dessen sprengt, was in der kleinen Rubrik „Schwer zu beantwortende Frage“ auf dieser Seite noch in pointierter Kurzfassung unterzubringen zu wäre. Das Problem dabei ist, dass es sehr viele, zu viele unterschiedliche Möglichkeiten der Beantwortung gibt, und dass es keine letztgültige Antwort darauf gibt, ob die Betrachtungsebenen, die zu unterschiedlichen Antworten führen, gleichberechtigt nebeneinander stehen, oder doch in einer Hierarchie angesiedelt sind, in welcher der Ober den Unter sticht, oder ob es eine solche Hierarchie zwar gibt, in der die einzelnen Ebenen jedoch, abhängig von äußeren (und inneren) Umständen untereinander die Positionen vertauschen.
Der Bund der Deutschen Länder – die Bundesrepublik Deutschland
Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und der ersten Lockerung des Besatzungsregimes entstand im Jahre 1949 das Völkerrechts-Subjekt „Bundesrepublik Deutschland“ aus dem Zusammenschluss der Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern, Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden. Acht Jahre später kam das Saarland dazu – und erst 1990 folgten durch Beitritt zur BRD die so genannten „Neuen Bundesländer“.
Die grundsätzlichen Regeln über die Kompetenzen von Bund und Ländern wurden im Grundgesetz von 1949 festgeschrieben und mit der Föderalismusreform von 2006 neu justiert. Trotz der mit der Föderalismusreform geschaffenen Veränderungen, haben sich die Länder dabei sowohl eigene Kompetenzen als auch den Vorbehalt der Zustimmung zu Bundesgesetzen durch den Bundesrat bewahrt.
Rein formaljuristisch betrachtet, muss die Frage daher anders gestellt werden, nämlich so:
Wozu braucht es in der Pandemie Angela Merkel, wo es doch Föderalismus, Bundesländer und Ministerpräsidenten gibt?
Und die Antwort fällt eindeutig aus: Der Bund ist in dieser Sache nicht gefragt, weil ihm die Kompetenz nicht zusteht, und – das ist wichtig – weil er mangels Kompetenz bisher nicht genötigt war, sich auf diesem Felde Wissen, Erfahrung und handlungsfähige Strukturen zu schaffen. Die wesentliche Aufgabe des Bundesministeriums für Gesundheit ist es nämlich, die gesetzliche Krankenversicherung leistungsfähig zu halten, während den Ländern primär die Aufgabe zufällt, die Struktur der medizinischen Versorgung und die Gesundheitsprävention sicherzustellen.
Optimale Organisationsstrukturen
Die eine, optimale Organisationsstruktur für alle Zwecke und Bedürfnisse gibt es nicht. Je nach Aufgabenstellung und Zielsetzungen kann zum Beispiel eine
zentralistisch-hierarchische Struktur sinnvoll sein, in der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung über mehrere Ebenen immer kleinteiliger delegiert werden, bis auf der untersten Ebene nur noch eindeutige und klare Vorschriften zu befolgen sind, während „Fälle“ die nicht in die bestehenden Regeln passen, wieder in die nächsthöhere Ebene zurückdelegiert werden müssen. Wir finden solche Strukturen bevorzugt beim Militär mit seinen straffen Befehlketten und Dienstgrad-Ordnungen, aber auch in stark zentralistisch geprägten Staaten, wie z.B. in Frankreich.
Unter anderen Voraussetzungen kann eine
dezentrale Struktur, in der kleine, autark operationsfähige Einheiten, die gleichberechtigt nebeneinander, aber vollkommen unabhängig voneinander ihre Aufgaben erfüllen, das Mittel der Wahl sein, um eine Aufgabenstellung optimal zu erledigen. Solche Strukturen bieten sich besonders in Vertriebs- und Service-Organisationen an, wo einzelne Niederlassungen autark ein bestimmtes regionales Gebiet betreuen.
Sowohl in zentralistsichen Strukturen als auch in dezentralen Strukturen werden gerne auch Elemente der
Matrixorganisation genutzt, um bestimmte, auf allen Ebenen, bzw. in allen autarken Gliederungen gleichartige Aufgaben zusammengefasst und einheitlich erledigen zu lassen. Es schönes Beispiel dafür sind die „Verwaltungsgemeinschaften“, zu denen sich mehrere kleinere Gemeinden zusammenschließen um dort die Funktionen des Einwohnermelde- und Standesamtes, der Baubehörde und des Gewerbe- und Sozialamtes von einer (kleinen) Zahl von qualifizierten Mitarbeitern betreuen zu lassen, während Bürgermeister und Gemeinderat vollkommen unabhängig davon in ihren Gemeinden nach geltendem Recht schalten und walten können, wie sie wollen.
Wo in Organisationen ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich ist, weil die Aufgaben der (gesamten) Organisation einem häufigen Wandel unterzogen sind, oder auf externe Ereignisse angemessen reagiert werden muss, hat die
Projektorientierte Organisation sich bewährt. Hierzu werden für jeweils aktuell anstehende Aufgaben temporär aus den vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen Teams oder Projektgruppen zusammengestellt, die nach Projektabschluss wieder aufgelöst und in anderer Zusammensetzung in andere, neue Projekte überführt werden. In der Regel herrscht in solchen Projektgruppen eine flache Hierarchie mit einem oder zwei Projektverantwortlichen in der Führung und der erforderlichen Zahl gleichberechtigter, hochspezialisierter Fachkräfte. Auch oberhalb der Projekte kann die Hierarchie flach gehalten und mit einer oder maximal zwei Ebenen optimal besetzt sein. Das Vorhandensein von Querschnittsfunktionen nach dem Matrix-Prinzip mit z.B. gemeinsamer Personalabteilung, zentralen Einkaufs- und Buchführungsfunktionen ist dabei in aller Regel unerlässliche Voraussetzung.
Betrachtet man die Aufgabe der Bewältigung einer Pandemie, so stellt sich heraus, dass diese aktuelle, neuartige, auf die Zusammenführung von Spezialisten angewiesene Arbeit, die zudem als eine temporäre Aufgabe anzusehen ist, unter den Bedingungen der Projektorientierten Organisation am besten gelöst werden könnte.
Daraus ergibt sich eine erneute Umstellung der Fragestellung:
Wozu braucht es in der Pandemie Angela Merkel, den Föderalismus, die Bundesländer und die Ministerpräsidenten, wenn es doch ein Projektteam aus Experten und Spezialisten gibt?
Auch hier fällt die Antwort eindeutig aus: Die Strukturen des Bundes und der Länder sind für eine derartige Aufgabenstellung nicht geschaffen, weil diese Aufgabe weit über das Abarbeiten grundsätzlich bekannter und nach Regelwerken zu behandelnder Geschäftsvorfälle hinaus in ein bisher nicht betretenes Neuland führt. Die Führungskräfte von Bund und Ländern wären jedoch in der Pflicht (wenn sie sich dessen bewusst wären) ein solches Projektteam ins Leben zu rufen, es mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten und dafür zu sorgen, dass die gewonnenen Erkenntnisse und die gefundenen Vorschläge für die optimale Pandemie-Abwehr entweder mit ihren Eigenmitteln in der eigenen, bestehenden Organisation umgesetzt werden, oder, sollte dies nicht möglich sein, eine eigene, temporäre Umsetzungsorganisation zu schaffen.
Parteipolitische Präferenzen
Das Grundgesetz lässt den Parteien sehr weite Spielräume, ihre eigenen Interessen – also den Machterhalt oder den Machtgewinn – zu verfolgen. Im föderalen Bundesstaat ist es daher kaum zu vermeiden, dass auch auf dem Gebiet der Pandemiebekämpfung die unterschiedlichen Koalitions-Konstellationen in den Bundesländern versuchen, mit „eigenen“ Patentlösungen bei ihren Wählern zu punkten und die Vorgehensweisen in anderen Bundesländern kritisch und warnend zu begleiten. Sofern diesen parteitaktischen Spielchen Priorität eingeräumt wird und vernünftige Lösungen aus diesen Gründen abgelehnt, blockiert oder öffentlich als ungeeignet bezeichnet werden, wird die Lösung der Aufgabe in unzulässiger Weise erschwert.
Da sich in Deutschland die Machtverhältnisse in Bund und Ländern in regelmäßigen Abständen verändern können, und es keinen gemeinsamen Chef aller Parteien gibt, unter anderem auch, weil das Amt des Bundespräsidenten nicht mit der notwendigen Machtfülle ausgestattet ist, um den Partikularinteressen der Parteien einen Riegel vorzuschieben, drängt sich ein weitere Umformulierung der Fragestellung in den Vordergrund:
Wozu braucht es in der Pandemie einen Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten der Länder, wo es doch in der ganzen Republik die gleichen Parteien gibt?
Die Antwort auf diese letzte Frage fällt ernüchternd aus. Weder die Parteien, in ihrer egoistischen Zerstrittenheit, noch die von den Parteien in die Ämter gehievten Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler können effektiv zur Bewältigung der Pandemie beitragen, solange Begriffe wie „gemeinsames Handeln“, „Geschlossenheit“ und „Gemeinwohl“ nur Lippenbekenntnisse bleiben, mit denen die Partikularinteressen, die ja leider inzwischen bis zur mehr oder weniger offenen persönlichen Bereicherung an der Pandemie geführt haben, gegenüber den Wählern vertuscht werden sollen.
Fazit
Die Situation in Deutschland ist mit „Eine gegen alle“ falsch beschrieben, obgleich der äußere Anschein für einen Kleinkrieg zwischen Angela Merkel und (fast) allen Ministerpräsidenten spricht. Wir erleben stattdessen die Ergebnisse einer auf dem Feuer der Pandemie überkochenden, vielfältig-bunten, parteipolitischen Instrumentalisierung der Krise, deren zügige Lösung allem Anschein nach nicht die erste Priorität hat. Dabei spielt die suizidale Neigung, die Interessen Deutschlands hinter die Interessen von EU und Drittweltstaaten zurückzustellen, eine wichtige Rolle, weil jahrelange mediale Berieselung die Massen auf jenen gesinnungsethischen Popanz eingeschworen hat, der die Duldung unkontrollierter Zuwanderung ebenso ermöglicht hat, wie die Entwicklung eines Schuldgefühls der – qua Hautfarbe – „rassistischen Weißen“ gegenüber allen Minderheiten dieser Welt.
Es fehlt die Kraft, dieses selbstgelegte Minenfeld, in dem das Volk eingehegt wurde, und aus dem niemand, der sich hineinwagt und damit zum Nazi wird, in das Reich der „wahren Demokraten“ zurückkehren kann, zu Gunsten einer nationalen Kraftanstrenung zu räumen und unter Bündelung aller Kräfte Schaden vom deutschen Volke abzuwehren. Stattdessen wird man nicht müde, die Schuld am Versagen in der immer ansteckender und immer tödlicher werdenden neuesten Mutation des Corona-Virus zu suchen, weil das Scheitern an einem übermächtigen Feind vom Volk einfach leichter entschuldigt wird, als das Versagen an einer Aufgabe, die durchaus zu bewältigen wäre, würde man ungeachtet eigener Empfindlichkeiten das tun, was angezeigt und notwendig ist. Ja, es sieht so aus, dass die Beschränkung auf einen engen, „zuverlässigen“ Beraterkreis auch den Zweck hat, gar nicht zu erfahren, was angezeigt und notwendig wäre, um es dann nicht entgegen eigener Vorstellungen durchsetzen zu müssen.
Es war Kaiser Wilhelm der Zweite, der am 4. August 1914, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs, vor dem Reichstag erklärte:
„Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche“.
Leider ist heute auf der politischen Bühne niemand zu erkennen, der in der Lage wäre, diesen Satz – aus innerer Überzeugung heraus und für die Menschen glaubwürdig – im Ankämpfen gegen die Pandemie noch einmal zu äußern.
Dann wäre es nämlich – egal ob der Kampf verloren oder gewonnen wird – ein gemeinsamer Sieg oder eine gemeinsame Niederlage, wofür niemandem die Alleinschuld, aber auch niemandem der alleinige Lorbeerkranz zugewiesen werden kann. Woran liegt es, dass Einigkeit und Recht und Freiheit heute gegenüber Kampf, Rechthaberei und der Unterdrückung von Kritikern derart ins Hintertreffen geraten sind?
Eine gegen alle? Das greift zu kurz.
Sollte Ihnen dieser Beitrag viel zu ernst und sachlich vorgekommen sein
und überhaupt nicht Ihrer Stimmung entsprochen haben:
Für solche Fälle gibt es Abhilfe.
Einfach im Nachgang jetzt noch einen der 42 satirischen Aufsätze lesen, die ich seit dem Herbst 2018 veröffentlicht habe.
Sie würden ja gerne, wissen aber nicht, wo die zu finden sind?
Ganz einfach:
|
|