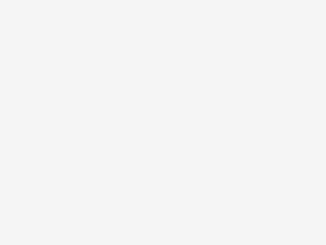Im Rat der EU ringt man darum, die Verschlüsselung privater Kommunikation, wie sie z.B. von 60 Millionen Deutschen per WhatsApp genutzt wird, auszuhebeln. Frankreich, das sich diesem Ansinnen lange widersetzt hat, ist jetzt auch umgefallen. Vielleicht schaffen es die Befürworter unter den Regierungen der Mitgliedsstaaten noch in dieser Woche, vielleicht schaffen sie es dieses Mal noch nicht, doch der Trend scheint unaufhaltsam.
We, the peoble, …
Diese Worte stehen am Anfang der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie stehen einzigartig für den Begriff der Demokratie. Mit den Montagsdemonstrationen von 1989 und den Sprechchören: „Wir sind das Volk!“, erlebten sie in der DDR eine – vom Westen bewunderte und geförderte – Renaissance. Eine kurzlebige Renaissance allerdings, denn schon der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen, der sich der gleichen Parole bedienen wollte, wurde – auch deshalb – des Rechtsextremismus bezichtigt. Es wurde von der Polizei sogar schon moniert, wenn Demonstranten eine gedruckte Ausgabe des Grundgesetzes sichtbar mitführten.
Wir lernen daraus, dass Regierungen zu feinen Unterscheidungen fähig sind, wenn es gilt, auf das erwachende demokratische Selbstbewusstsein des Volkes zu reagieren.
Nach dieser Lektion, die eine quasi naturgesetzliche Wahrheit ans Licht gebracht hat, bleibt die Frage übrig: „Ist das gut so, oder eher schlecht?“
Mit der Chatkontrolle geht es gleich mehreren grundgesetzlich verbrieften Bürgerrechten noch einmal verstärkt an den Kragen.
- Das Post- und Fernmeldegeheimnis wird noch ein Stück weiter entkernt.
- Die Meinungsfreiheit, die das Recht auf öffentliche Meinungsäußerung in Wort, Schrift und Bild garantiert, weil andererseits die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Post- und Fernmeldegeheimnis die nicht öffentliche Meinungsäußerung schützen, gilt nicht einmal mehr in der nicht öffentlichen, privaten Kommunikation, wie sie Chat-Dienste nun einmal ermöglichen.
- Die Würde des Menschen wird zutiefst verletzt, wenn der Staat überzeugt ist, er habe das Recht, die geheimsten Gedanken seiner Bürger auszuforschen, zu bewerten und letztlich zu verurteilen. Das erinnert schon sehr an die Käfighaltung vollständig entrechteter Gefangener auf Guantanamo.
Sicherlich, das klingt nicht gerade so, als sollten wird darüber in Jubel ausbrechen. Doch bevor wir uns von den Wogen der Empörung davontragen lassen, gilt es doch, auch die andere Seite zu hören. Auf dieser anderen Seite stehen doch nicht Verbrecher, die nach der Weltherrschaft streben, wie der von James Bond gejagte Ernst Stavro Blofeld. Auf der anderen Seite stehen ehrbare Männer und Frauen, allesamt Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der EU, die letztlich doch irgendwie von den Wahlberechtigten in ihren Nationalstaaten beauftragt wurden, ihre Interessen in der EU zu vertreten.
Die mit der Chatkontrolle angestrebten Ziele kann ja auch niemand ablehnen. Es geht um den Kampf gegen die organisierte Kriminalität, um den Kampf gegen den Terror, sicherlich auch um den Kampf gegen den politischen Extremismus, und um den Kampf gegen die Kinderpornografie. Für diese wichtigen Anstrengungen zum Schutz der Bürger gelte es, Waffengleichheit herzustellen. Es könne nicht angehen, dass sich Straftäter, Terroristen, Extremisten und Kinderpornoringe im Internet wie in einem rechtsfreien Raum nach Belieben austoben, während die Ermittler ausgeschlossen bleiben und keine Chance haben, den Verbrechern auf die Spur zu kommen und gerichtsfeste Beweise zu sammeln.
Das Problem liegt nicht in den Zielen.
Das Problem liegt darin, dass zur Erreichung dieser Ziele die Unschuldsvermutung, als ein Kernbestandteil unseres Rechtssystems außer Kraft gesetzt und durch die Pauschalverdächtigung aller Bürger ersetzt wird, weil der Staat es neuerdings als seine vordringliche Aufgabe ansieht, mögliche Straftaten – und was er dafür hält – präventiv zu verhindern, potentielle Täter bereits vor der Tat aufzuspüren und unschädlich zu machen, anstatt begangene Straftaten aufzuklären, die Täter zu verfolgen und zu bestrafen.
Die technischen Mittel dafür sind vorhanden. Warum also diese Mittel nicht flächendeckend einsetzen?
Wie sieht die Güterabwägung aus?
Wie viele Straftaten und Terrorakte müssen verhindert werden, um ein ausreichendes Gegengewicht für den Verlust der Freiheitsrechte der Bürger ins Feld führen zu können?
Hier greift zweifellos das Stop-Schild-Paradoxon, das sich kurz gefasst so auf den Punkt bringen lässt: Ist das Stop-Schild an der Kreuzung überflüssig, wenn dort jahrelang kein Unfall mehr passiert ist?
So, wie das Stop-Schild bleibt, werden auch die technischen Mittel und Methoden zur anlasslosen Massenüberwachung bleiben, wenn weder Terroristen Anschläge verüben, noch Kriminelle ihre Verbrechen begehen.
Selbst wenn die Überwachung der elektronischen Kommunikation tatsächlich ursächlich dafür wäre, dass nichts mehr passiert, muss man sich fragen: „Was macht das mit den Menschen? Welche Macht gibt das dem Staat?“
Friedrich Schiller, der Revoluzzer, hat die Antwort in seinem Don Carlos gegeben. Der Marquis von Posa hat seinem König vorgehalten, sich selbst zum Gott erhoben zu haben und die Menschenwürde seiner Untertanen nicht zu achten. Hier ein paar Sätze aus dem dritten Akt.
Ich höre, Sire, wie klein, wie niedrig Sie von Menschenwürde denken, selbst in des freien Mannes Sprache nur den Kunstgriff eines Schmeichlers sehen, und mir deucht, ich weiß, wer Sie dazu berechtigt.
Die Menschen zwangen Sie dazu; die haben freiwillig ihres Adels sich begeben, freiwillig sich auf diese niedre Stufe herabgestellt.
Erschrocken fliehen sie vor dem Gespenste ihrer innern Größe, gefallen sich in ihrer Armut, schmücken mit feiger Weisheit ihre Ketten aus, und Tugend nennt man, sie mit Anstand tragen.
So überkamen Sie die Welt. So ward Sie Ihrem großen Vater überliefert.
Wie könnten Sie in dieser traurigen Verstümmlung – Menschen ehren?
Die Rede des Marquis gipfelt in der weithin bekannten Aufforderung: „Gewähren Sie Gedankenfreiheit!“
Die Uraufführung des „Don Carlos“ fand übrigens 1787 in Hamburg statt.
Eine ferne Zeit.
Doch auch mehr als 200 Jahre später, im so oft gepriesenen, besten Deutschland aller Zeiten, mit Grundgesetz, Wahlrecht und Demokratie, soll es wieder Zeichen der Tugend sein, die „von irgendeinem Oben“ auferlegten Ketten mit feiger Weisheit auszuschmücken und mit Anstand zu tragen.
Wer erinnert sich noch an die Schulaufführung? An den Aufsatz, der darüber zu schreiben war, an das Hohe Lied der Demokratie in Deutschland, das da laut gesungen wurde, und an den mehr oder minder deutlichen Hinweis, dass Schiller einer von denen gewesen sei, die – ihrer Zeit voraus – UNSERE Gedankenfreiheit erkämpften.