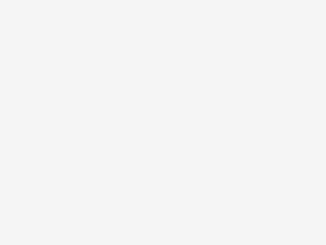PaD 9 /2020 – Hier auch als PDF verfügbar: PaD 92020 Alle plus X
Alles – plus X
Das moderne, hochgradig arbeitsteilige, und daher auf der Leistung abhängig Beschäftigter aufbauende System des Wirtschaftens akzeptiert als Erfolg unternehmerischen Engagements ausschließlich die Mehrung des ursprünglich eingesetzten Kapitals.
Damit hat sich unsere moderne, hochgradig arbeitsteilige Gesellschaft von den eher kooperativen Formen der Zusammenarbeit früherer Epochen, wo „das Dorf“ als wirtschaftlich autarke Einheit die Kapazitäten der benötigten Gewerke im richtigen Verhältnis zueinander wie von alleine rings um den Kirchturm versammelte, weit entfernt.
Es geht nicht mehr der ganzen Gesellschaft gut, wenn die Landwirte eine gute Ernte einfahren können, weil weit über die Region hinaus wirkende „Marktkräfte“ dafür sorgen, dass eine „gute Ernte“ die Preise verdirbt.
Im Extremfall ist die zu gute Ernte die Ursache für Armut und Not, so dass sich schon oft vermeintlich als sinnvoll erwiesen hat, wofür – systembedingt – keine andere Lösung gefunden werden konnte, nämlich die Überschüsse guter Ernten zu vernichten, Tomaten ins Meer zu kippen, Kartoffeln und Mais unterzupflügen, Obst zu ungenießbaren Industriealkoholen zu verarbeiten, Butter und Milchpulver zu unsinnig niedrigen Preisen in ferne, ausländische Märkte zu verbringen, nur um den Preis für die Menge des inländischen Verbrauchs so hoch halten zu können, dass die Bauern (nicht alle, aber genügend viele) ihre Kredite bedienen und nicht Insolvenz anmelden müssen.
Dass da etwas faul ist, vermuten die meisten.
Was da jedoch faul ist, hat kaum jemand begriffen.
Ein Aspekt der Ursache wurde schon im ersten Satz dieses Paukenschlages angesprochen. Wo ein Rechtssystem ein Wirtschafts- und Staatsfinanzierungssystem hervorgebracht hat, das nur funktioniert, wenn – über die angemessene Entlohnung für die erbrachte Leistung hinaus – ein zusätzlicher „Gewinn“ erwirtschaftet wird, stellt sich uns ein scheinbar unlösbares Rätsel. Schließlich wissen wir, dass ein Großteil dieser Gewinne als „Erspartes“ in Form von Geldanlagen angehäuft wird und damit ein Teil der Liquidität aus dem Wirtschafts- und Geldkreislauf herausgezogen wird. Es ist einfach so, dass die Million Euro auf dem Sparbuch des Millionärs von niemandem genutzt werden kann, also „nutzlos“ herumliegt, so lange der Millionär sein Geld nicht abhebt und es ausgibt. Trotzdem nimmt das Geld scheinbar nie ein Ende.
Was hat das nun mit dem Preisverfall der Tomaten zu tun?
Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wenn zigtausende von Millionären und einige hundert Milliardäre miteinander ein paar tausend Milliarden Euro an Liquidität aus dem Wirtschaftskreislauf entnommen und diese Liquidität stillgelegt haben, was ja in Deutschland der Fall ist, dann sollte die gesamte Wirtschaft schon längst an Geldmangel zugrunde gegangen sein.
Da wir uns mit eigenen Augen bei einem Blick aus dem Fenster davon überzeugen können, dass dem nicht der Fall ist, gelangen wir zu der Erkenntnis, dass der Verlust an Liquidität der durch Geldhortung zweifellos stattgefunden haben muss, offenbar weitgehend kompensiert werden konnte. Die Quelle für die frische Liquidität ist auch schnell gefunden: Das Geld stammt ganz überwiegend aus Krediten.
Beim Kredit stellt sich – selbst beim derzeit niedrigen Zinsniveau – stets heraus, dass die Inanspruchnahme der Liquidität mit einer Gebühr bezahlt werden muss, die sich „Zins“ nennt. Das heißt, der Kreditnehmer muss dem Kreditgeber insgesamt mehr Geld (zurück-) zahlen als er von diesem erhalten hat.
Alles – plus X!
Damit ihm das möglich ist, muss er – als Tomatenzüchter – aus dem Verkauf seiner Tomaten mehr erlösen, als vor der Inanspruchnahme des Kredits. Weil nicht damit zu rechnen ist, dass sich höhere Preise durchsetzen lassen, wird er versuchen, die Menge seines Ernte-Ertrages zu steigern, im Zweifelsfall also noch ein Stück Land dazunehmen, oder durch Düngung oder künstliche Bewässerung (was alles ebenfalls zusätzliche Kosten verursacht) dafür sorgen, dass am Ende des Sommers mehr Tomaten von den Sträuchern geholt werden konnten, als im Vorjahr.
Mit dieser Strategie hat er gewonnen, wenn die Preise für Tomaten stabil bleiben oder gar steigen. Dies ist allerdings eher nicht zu erwarten, denn die durch Kredite zu kompensierende Liquiditätslücke trifft ja die ganze Volkswirtschaft, und nicht nur einen einzigen Tomatenzüchter. Es werden also die meisten Tomatenzüchter in der gleichen finanziellen Situation stehen und auf ähnliche Weise darauf reagieren.
Wenn nun die meisten Tomatenzüchter entschieden haben, zur Finanzierung der vor der Ernte anfallenden Kosten Kredite aufzunehmen, und von daher gezwungen waren, die Erntemengen zu erhöhen, aber die Nachfrage nach Tomaten nicht gewachsen ist, wird die „Marktbereinigung“ nicht lange auf sich warten lassen.
Dies geschieht regelmäßig so, dass die Preise für Tomaten sinken und dabei diejenigen Tomatenzüchter mit den relativ zum Umsatz höchsten Kosten in die Insolvenz getrieben werden, was das Angebot an Tomaten reduziert und die Preise wieder etwas anziehen lässt. Haus und Hof der Verlierer landen nicht selten in der Zwangsversteigerung und gehen weit unter Wert an einen Anleger, der sich freut, „Geld“ in eine Sachwertanlage umgewandelt zu haben, während die Bank den Erlös aus der Versteigerung gut nutzen kann, um den Verlust aus dem geplatzten Kredit zu minimieren.
Das war, wie angesprochen, der eine Aspekt, den es zu beachten gilt. Daneben findet sich jedoch noch ein weiterer Aspekt, der allerdings noch seltener thematisiert wird – und falls doch, dann mit der völlig falschen Schlussfolgerung.
Die Erkenntnis lauert hinter der Frage: Wie viel menschliche Arbeit ist erforderlich, um einer Million Menschen einen definierten Lebensstandard zu ermöglichen?
Natürlich haben Sie Recht, wenn Sie gegen diese Frage zunächst einmal Einspruch erheben, weil ja nicht nur der Lebensstandard noch zu definieren wäre, sondern vor allem die Qualität der menschlichen Arbeiter und die Leistungsfähigkeit der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel.
Eigentlich habe ich mir diesen Einspruch sogar gewünscht, weil sich ohne weitere Festlegung nämlich trotzdem schon ein Satz der Erkenntnis formulieren lässt, der da lautet:
„Je höher der Stand der Technik, desto weniger menschliche Arbeit wird benötigt, um einen definierten Lebensstandard zu ermöglichen.“
Dieser Satz, so schlicht er auch daherkommt, hat es in sich!
Die Dramatik dieses Satzes offenbart sich darin, dass „Gewinne“ nur aus der „Ausbeutung“ menschlicher Arbeit entstehen können, wobei „Ausbeutung“ einfach nur meint, dass die Arbeit um einen gewissen Betrag unter ihrem eigentlichen Wert entlohnt wird, weil nur aus der Differenz zwischen erzieltem Umsatz und gezahltem Lohn überhaupt ein Gewinn erzielt werden kann.
Die betriebswirtschaftliche Einteilung in eine Vielzahl von Kostenarten ist hier irreführend. Grundsätzlich gilt: Alles, womit der Mensch arbeiten kann, ist seit Beginn der Zeit kostenlos verfügbares Inventar des Planeten. Eigentumsrechte, die es erlauben, auf die Nutzung dieses kostenlosen Inventars durch Dritte eine Gebühr zu erheben, zählen in der Gesamtbetrachtung zu den „Gewinnen“, nicht zu den Kosten, weil sie leistungslose, bzw. absolut nicht leistungsadäquate Einkünfte darstellen.
Wenn das verstanden ist, wird klar, dass die Höhe des möglichen Gewinnes (bei großen branchenspezifischen Unterschieden) in direktem Zusammenhang mit der Zahl der Beschäftigten steht, weil die Zahl der Beschäftigten, bei vergleichbarer technischer Ausrüstung die Produktionsmenge bestimmt, während der Lohnanteil pro Mengeneinheit (die Lohnstückkosten) die prozentuale Höhe des Gewinns ausdrückt, solange der erzielbare Verkaufspreis höher liegt.
Hohe Produktionsmengen zu niedrigen Kosten herzustellen, das dient nicht vordringlich der Befriedigung des Bedarfs zu erschwinglichen Preisen, sondern einzig der Gewinnmaximierung der Unternehmen.
Daraus wiederum wird klar, warum es sich große Industrieunternehmen gar nicht mehr leisten können, langlebige Gebrauchsgüter in den Markt zu werfen und alles, was im Grunde nicht kaputtgehen kann, zumindest einer Mode zu unterwerfen, die regelmäßige Neuanschaffungen erforderlich macht.
Im Grunde war dies alles bereits vorgezeichnet, als der Amerikaner King Camp Gilette den Rasierhobel und damit den ersten Wegwerfartikel der Geschichte erfunden hatte, der ab 1901 vermarktet wurde.
War ein Rasiermesser vorher eine „Anschaffung fürs Leben“ entstand mit dem Rasierhobel und seinen bis heute für die Nassrasur verwendeten Klingenpaketen die Notwendigkeit des lebenslangen Nachkaufens von Klingen, was die Rasiermesserproduzenten in den Ruin getrieben, Gilette und Wilkinson aber bis heute zu Renditegroßmeistern auf dem Weltmarkt werden ließ.
Lassen Sie es sich ganz langsam noch einmal durch den Kopf gehen:
Lohnarbeit dient primär der Gewinnerzielung des Arbeitgebers.
Das bedeutet theoretisch, dass die Summe der Löhne aller Arbeitnehmer zwangsläufig kleiner bleiben muss als die Summe der Umsätze aller Arbeitgeber.
Praktisch überprüfen können Sie diesen Effekt in jedem Geschäftsbericht der veröffentlichungspflichtigen Unternehmen unter dem Titel „Gewinn- und Verlustrechnung“. Dass die Verhältnisse bei nicht veröffentlichungspflichtigen Unternehmen anders sein sollten, kann ausgeschlossen werden. Schon alleine deshalb, weil das zuständige Finanzamt, wenn es keine Gewinnerzielungsabsicht erkennen kann, dem Unternehmer erklärt, bei seiner Unternehmung handle es sich um sein privates Hobby, was zu ganz erheblichen Steuernachforderungen führen kann und letztlich die Schließung des Unternehmens nach sich zieht. Das Hobby darf natürlich weiter betrieben werden, aber die dafür anfallenden Kosten können in keiner Weise steuerlich geltend gemacht werden.
Warum funktioniert das Spiel dennoch?
Zunächst einmal funktioniert es, weil die große Masse der abhängig Beschäftigten absolut nicht einzuschätzen weiß, was ihre Arbeitsleistung in Euro und Cent wert ist und sich folglich mehr oder weniger murrend mit dem zufrieden gibt, was unten rechts als „Netto“ auf dem Lohnzettel steht.
Das Netto-Einkommen bestimmt den Lebensstandard.
Das Netto-Einkommen bestimmt, in welchen Geschäften welche Waren welcher Qualität in welchen Mengen gekauft werden können. Es bildet sich wie von selbst eine Klassengesellschaft heraus, an deren unterem Ende jene stehen, nennen wir sie die „Klasse 1“, die sich notwendigerweise an die Sonderangebote der Billigst-Discounter halten müssen, wollen sie nicht den beschwerlichen Weg in die Privat-Insolvenz gehen.
Allerdings kann man erkennen, alleine wenn man die Liste der deutschen Milliardäre betrachtet, dass die Eigentümer der Billigst-Discounter zu den reichsten Menschen der Republik gehören, also auch am billigsten Käse aus ihren Kühlregalen noch satt verdienen müssen.
Dies wiederum zwingt zu der Erkenntnis, das es unter der untersten sichtbaren Klasse der Klassengesellschaft noch „welche“ geben muss, deren niedrige Löhne es im Verein mit der nicht immer lobenswerten Qualität des Angebotes möglich machen, die Kosten des Discounters noch deutlich unter den niedrigen Preisen zu halten.
Diese „Welchen“ setzen sich aus drei Gruppen von Ausgebeuteten zusammen, die miteinander die „Klasse 0“ bilden:
Erstens sind es Arbeiter – oft genug Kinder – in den ärmsten Regionen der Welt, die unter erbärmlichen Bedingungen und für einen echten Hungerlohn die Produkte schaffen, die der Billig-Discounter zu den von ihm diktierten Preisen einkauft.
Zweitens sind es Arbeitssklaven aus dem näheren Ausland, die legal und zum Teil auch illegal die halbe Nacht und den ganzen Tag in den deutschen Filialen den Schmutz wegräumen und die Regale füllen, oft genug organisatorisch in eigenen Tochtergesellschaften geführt, oft genug in eigens angemieteten Gemeinschaftsunterkünften zusammengepfercht und auf Zuruf jederzeit mal hier, mal da, zum Einsatz verpflichtet.
Drittens sind es die Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Enten, Ziegen, alle unsere „verwertbaren“ Mitgeschöpfe, die unter minimalsten Lebensbedingungen mit miserabelsten Futtermitteln schnellstmöglich zur Schlachtreife gebracht werden. Es sind die Ackerböden, die von Riesentraktoren verdichtet, mit Kunstdünger überfrachtet und vor Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden strotzend nach und nach abgetötet werden und nur noch als ein Substrat dienen, an dem sich Wurzeln festhalten, so dass die Pflanzen nicht gleich nach dem Austreiben umfallen, es sind die Meere, die zu Müllkippen gemacht werden und es ist die Luft, die mehr und mehr mit Schadstoffen angereichert wird.
Schon ist das Prinzip sichtbar. Eine jeweils untere Klasse erarbeitet für niedrige Löhne die Produkte die von den Angehörigen der darüber stehenden Klassen mit höheren Löhnen erworben werden sollen.
Bis auf die allerhöchste Klasse richten sich alle unteren Klassen mit dem ein, was als Netto auf dem Gehaltszettel steht, und weil auch die in der zweithöchsten Klasse, wo hauptsächlich die Vorstände der Großkonzerne versammelt sind, zwar erkennen können, was ihre Arbeit wert ist, diesen Wert aber – mangels ausreichender Machtmittel – nicht einfordern können, geben auch die sich – mehr oder weniger murrend – mit dem zufrieden, was ihnen gegeben wird.
(10 Millionen, einschließlich Boni, als Jahresgehalt für einen Manager, der den Aktionären pro Quartal mehr als eine Milliarde Gewinn erwirtschaftet, das ist eine Beteiligung von ungefähr 0,2 Prozent! Jede Floristin, die zum Mindestlohn Sträuße bindet, kommt locker auf einen um das Fünfzigfache höheren Anteil am Ertrag ihrer Arbeit.)
Ein echter Widerstand gegen die Ausbeutung lässt sich kaum organisieren, weil die feine Unterteilung in Klassen die Solidarität unterhöhlt, und weil halt wirklich niemand weiß, was seine Leistung wert ist und was ihm folglich fairerweise als Gegenleistung, ausgedrückt im Lebensstandard, dafür zustünde.
Nun zur zweiten Erklärung, warum das Spiel dennoch funktioniert:
Der Kapitalismus in Gestalt des Neoliberalismus lebt vom sozialen Gewissen. Nicht dass er es hätte. Nein, nein. Aber er fördert es überall da, wo immer noch etwas umverteilt werden kann. Wo es zwischen arm und reich nichts mehr gibt, kann auch nichts mehr abgegriffen werden. Daher öffnet er über die Globalisierung die Grenzen, um sich neue „Mittelschichten“ (zwischen den Volkswirtschaften) zu schaffen und dann an das Soziale Gewissen zu appellieren mit dem Satz:
Wo alle satt werden, werden auch
Alle – plus X
satt.
Der Grund dafür ist einfach nachzuvollziehen: „Alle – plus X“ sind ein um „X“ größerer Absatzmarkt als „Alle“ alleine. „Alle – plus X“ verzehren mehr, brauchen mehr Hoodies, mehr Wohnraum, mehr Smartphones, mehr Pillen und mehr Särge. Da spielt es keine Rolle, wenn „plus X“ nichts zur Leistungserstellung beiträgt, kein eigenes Einkommen erwirtschaftet, sondern von Transferleistungen lebt. Es spielt auch keine Rolle, ob es sich bei „plus X“ um die EU-Wanderarbeiter aus dem ehemaligen Ostblock handelt, oder um die von Erdogan in der Türke festgehaltenen Flüchtlinge, deren Unterhalt von der EU gesichert wird. Wichtig ist, dass denjenigen, die ein Einkommen haben, dieses Einkommen auf dem Wege der staatlichen Umverteilung weggenommen wird, dass sie also möglichst nichts sparen können und dass sie ihre Ansprüche an ihren Lebensstandard senken, was die Gewinnspannen erhöht. Wie bereits erwähnt gehören die Eigentümer der Billigdiscounter zu den reichsten Menschen im Lande – und das nicht zufällig. Gelingt es ihnen doch „alternativlos“ am Ende der Verwertungskette zu stehen und dort restlos alles abzusaugen.
Die dritte Erklärung, warum das Spiel dennoch funktioniert:
Die Vernünftigeren unter den staatlichen Umverteilern erkennen, dass die Belastung der Leistungserbringer und die großzügige Alimentierung der für die Leistungserstellung nicht benötigten Menschen trotz aller sozialen und humanistischen Begründungen als „irgendwie ungerecht“ empfunden wird und geeignet ist, den Frieden zu stören.
Also ziehen sie los und argumentieren: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“
Dies ist der Startschuss für das, was man den „Ausbau des Dienstleistungssektors“ nennt. Menschen werden animiert, sich als „Diener“ anderer Menschen zu verdingen, und auf diese Weise den Umfang der offiziellen Umverteilung kleiner erscheinen zu lassen, obwohl ja selbst der in Deutschland hoch entwickelte Beruf des Pfandflaschensammlers nichts anderes ist als die Substitution staatlicher Umverteilung durch einen freiwilligen Beitrag zur Alimentation der Angehörigen der Klasse 1. Überall, wo es früher üblich war, ein Trinkgeld zu geben, ob nun beim Frisör, bei der netten Bedienung im Restaurant oder beim Paketboten, erleben wir, weil auch in den Klassen 2, 3 und höher die Luft allmählich dünner wird, den Ersatz des Trinkgeldes durch den Mindestlohn.
Der Mindestlohn ist keine soziale Großtat!
Der Mindestlohn ist, wie die Grundsicherung, ein unverzichtbares Element zur Generierung von Gewinnen bei den Billigst-Discountern. Er trägt auch dazu bei, die Rentabilität von abgewirtschafteten Immobilienbeständen zu gewährleisten. Das gelingt, weil unser aller Denken so geformt worden ist, dass wir die Nutznießer hinter den „sozialen Wohltaten“ nicht mehr erkennen können, ja nicht einmal mehr erkennen wollen, weil uns eine Welt, in der die mildtätigen Transferleistungen fehlen, wie die Hölle vorkommt, was allerdings nur so lange realistisch ist, wie wir überzeugt sind, den unschuldigen Opfern des Wirtschaftssystems müsse geholfen werden, weil am System selbst nichts geändert werden könne.
Mit den bisher vorgestellten Erklärungen wird erkennbar, wie sich Gewinne dadurch generieren lassen, dass die gesamte Bevölkerung Schritt für Schritt durch eine von unten her ansetzende Erosion der verfügbaren Einkommen und der Vermögen ausgeplündert wird.
Das alleine würde allerdings nicht funktionieren, hätten wir nicht ein Geldsystem, das stets dafür sorgt, die durch Hortung stillgelegte, bzw. in die Finanzsphäre verschobene Liquidität auf wundersame Weise soweit zu ersetzen, dass die Gewinne niemals in Gefahr geraten können.
Alles – plus X
Sie wissen es, und ich weiß es, „Alles – plus X“ ist eine Illusion, die sich nicht realisieren lässt. Es sei denn, X hat den Wert null.
Dass dies für Geld nicht gelten soll, dass Geld unbegrenzt vermehrt werden kann, dass sich die Notenbanken sogar gezwungen sehen, immer neue Geldfluten auszulösen, wie jetzt wieder, um wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise gar nicht erst entstehen zu lassen, wirft doch tausend Fragen auf, auf die es immer nur eine Antwort gibt: „Wahnsinn!“
Nächste Woche werde ich einige dieser Fragen aufgreifen und unter anderem versuchen herauszufinden, ob irgendwie so etwas wie eine natürliche Obergrenze der Geldmenge, des Geldvermögens und der Geldschulden ermittelt werden könnte und wohin die Reise zwangsläufig gehen wird, wenn eine solche Obergrenze nicht in naher Zukunft implementiert werden wird.
Dazu passend: Ein paar Takte Mafia-Philosophie aus „Der Goldesel“
„Platon“, fuhr Don Rimerco in seinem Monolog fort, und dabei erhob er sich von seinem Platz und begann, sich mit großen Gesten in Szene zu setzen, „Platon war dreimal auf Sizilien, immer den Kopf voller Flausen, hauptsächlich darüber, wie der ideale Staat zu gestalten und zu regieren sei. Dionysios der Erste, der Tyrann von Syrakus, hörte ihm nicht lange zu, er ließ ihn auf dem Sklavenmarkt feilbieten. Nun ja, er wurde freigekauft und er kam wieder, aber auch Dionysios der Zweite, den er danach für sich gewinnen wollte, war seinen Ideen nicht besonders zugeneigt und so fuhr er erneut unverrichteter Dinge nach Hause. Nach seinem dritten Aufenthalt in Sizilien gab er es dann – in tiefer Verbitterung – völlig auf, Staatsideale zu ersinnen. So enden viele, wenn sie erkennen, dass sich die Wirklichkeit nicht nach ihren Idealen formen lassen will.
Aber dieser Platon hat eine Weisheit hinterlassen, die auch auf Sizilien Gültigkeit erlangte und die ich meinem Leben vorangestellt habe:
‚Der Tugendhafte begnügt sich!‘, sagte Platon, und womit?
‚Der Tugendhafte begnügt sich, zu träumen!‘, sagte Platon, und wovon?“ Don Rimerco lachte spöttisch auf und hob die Stimme gewaltig an:
„Der Tugendhafte begnügt sich, von dem zu träumen,
was der Böse im Leben verwirklicht.“
Er ließ seine Worte wirken, bevor er in normaler Lautstärke zu einer Erklärung ansetzte: „Ich habe früh aufgehört zu träumen und stattdessen angefangen, meinen Willen zu verwirklichen. Ich habe früh aufgehört, die Tugenden als Wert an sich zu üben und sie stattdessen als besondere Werkzeuge nur dann eingesetzt, wenn mir dies im Umgang mit den Menschen und der Macht als nützlich erschien.
Vielleicht bin ich böse. Vielleicht sind wir alle, die wir heute einem Verrat entgangen sind, böse. Aber wir leben! Wir gestalten die Welt und die tugendhafte Isabella, die träumend und betend am Leben vorbeiging, ist tot und wird nichts mehr bewegen. Auch der weitaus weniger tugendhafte Giuseppe – Gott sei ihm gnädig – begnügte sich, zu träumen, denn er hat in seinem kurzen Leben nichts verwirklicht, was zu erwähnen sich lohnte.“
Don Rimerco schaute fragend in die Runde. Seine Gäste wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten, seine Rede war nicht leicht zu deuten. War es purer Zynismus oder doch eher ein Zeichen von Anmaßung und Überheblichkeit? War es eine in höhnischen Worten daherkommende, bittere Selbsterkenntnis oder doch nur die beifallsüchtige Zurschaustellung einer einfachen, wie aus rohen Brettern zurechtgezimmerten Philosophie? Suchte der Pate von Palermo eine Entschuldigung für sich, oder wollte er seinen Gästen mit diesen Worten moralische Werte und Orientierungshilfen vorgeben?
Bevor sich einer seiner Zuhörer angesprochen fühlen konnte, fuhr er fort: „Wir leben! Und wir werden jetzt weiterarbeiten.“ Er nahm wieder am Kopf des Besprechungstisches Platz und als er weitersprach war sein Ton geschäftsmäßig kühl: „Es war für heute geplant, endgültig über den MVV-Weg zu beschließen, und genau das werden wir jetzt tun.“
Neugierig, was das ist, der MVV-Weg?
„Habe ich das richtig verstanden? Da fahren zwei Busse durch München, öffentliche Busse?“
„Ja“, Fred nickte.
„Und diese Busse fahren ganz verschiedene Routen?“
Wieder nickte Fred.
„Und dann steigt ein Mann mit der Ware in den einen Bus und ein Mann mit dem Geld in den anderen Bus?“
„Ja, so soll das ablaufen.“
Abdul fragte weiter und weiter und während Fred ihm bestätigte, dass nicht jeder Platz in einem Bus für die Übergabe geeignet ist, dass es günstige und ungünstige Zeiten für die Transaktionen gibt, dass die Wagennummern der Busse per Handy an die Abholer weitergegeben werden, die zwei Stationen später einsteigen, um Ware oder Geld vom Kurier zu übernehmen, während Fred also mit Engelsgeduld zuhörte, wie Abdul das Konzept aus dem Gedächtnis wiederholte, spürte er wie Raizas Nähe ihn immer stärker beanspruchte, seine Aufmerksamkeit und Konzentration abzog, wie seine Gedanken immer weniger bei der Sache waren, immer öfter abschweiften, wie eine Art von Magnetismus an ihm zerrte und verlangte, dass er sich der Frau, die so nahe bei ihm saß zuwandte, sie ansah, sie berührte.
Erst als Pierre van Niem in den Raum kam und sich, ohne zu fragen, wie selbstverständlich mit an den Tisch setzte, löste sich die Spannung auf und Fred konnte wieder normal denken, in zusammenhängenden Sätzen reden und unverkrampft atmen.
„Na, hat Abdul inzwischen begriffen, worum es geht?“, frozzelte der gebürtige Niederländer, bevor er dazu überging sich zu vergewissern, dass er auch selbst alles richtig verstanden hatte. „Sie wollen die Wagennummern der Busse, in die die Kuriere eingestiegen sind, per SMS weitergeben? Ist das nicht viel zu unsicher? Mir wäre lieber, wenn die Beteiligten sich an der Stimme erkennen könnten! Damit wäre jedenfalls sichergestellt, dass sich kein Fremder einmischt, und die Kontrolle übernimmt.“
Fred erläuterte, dass die SMS unauffälliger abzusetzen sei, niemand könne zufällig etwas aufschnappen, aber van Niem blieb bei seinen Bedenken: „Es geht hier nicht nur um die Sicherheit der Kuriere und um den Wert einer Lieferung, es geht auch um unsere Sicherheit. Glauben Sie mir, wenn jemand das System durchschaut und sich in die SMS-Meldungen einschaltet, schickt er alle Beteiligten der Polizei in die Arme und einer singt dann bestimmt. Einer singt immer.“
448 Seiten „Der Goldesel“, Printausgabe, bei BoD bestellen?