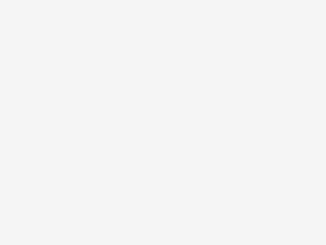Ach, was muss man oft von bösen
Deckeln hören oder lesen,
wie zum Beispiel hier von diesen,
welche in Berlin grad sprießen:
Der Duden kennt drei Bedeutungen des Wortes „Deckel“, nämlich
-
aufklappbarer oder abnehmbarer Verschluss eines Gefäßes, Behälters, einer Kiste, eines Koffers, Möbelstücks
-
vorderer oder hinterer Teil des steifen Umschlags, in den ein Buch eingebunden ist
-
Kopfbedeckung (salopp)
Wie ist nun die Miete einzuordnen, die einen Deckel erhalten soll?
Die Miete ist weder Gefäß noch Kiste, sie ist auch kein Buch und ganz bestimmt keine Schiebermütze. Daraus geht semantisch eindeutig hervor, dass Miete und Deckel in keinem irgendwie gearteten Verhältnis zueinander stehen können, weshalb die Deckelung nur schiefgehen kann. Alleine deshalb, weil jeder Deckel eine bestimmte geometrische Form mit festgelegten Abmessungen haben muss, wenn er zum Gefäß, zur Kiste, zum Buch oder eben zum Quadratschädel passen soll, während es „die Miete“ in der Realität gar nicht gibt, sondern lediglich Millionen von unterschiedlichen Mietverträgen mit unterschiedlich vereinbarten Miethöhen, die von einem Einheitsdeckel gar nicht verschlossen werden können.
Gut, Sie haben Recht, rein sprachlich darf hier nicht argumentiert werden, obwohl es immer wieder frappierend ist zu sehen, wie Begriffe und ihre Bedeutung das Denken prägen, ja vorherbestimmen. In diesem Fall sieht es so aus, als sei der Begriff „Deckel“ gewählt worden, um ein falsches „Framing“ herzustellen, um zu suggerieren, man könne Mieten mit Deckeln in den Griff bekommen. Verzeihen Sie die schiefe Analogie: Mir kommt es vor, als wolle man die überschießende Milch im Topf auf der heißen Herdplatte dadurch bremsen, dass man einen Deckel darauf setzt. Ältere Hausfrauen, die noch wissen, wie es ist, wenn man Milch zum Kochen bringt, wissen, dass die einzige und letzte Chance, die ganz große Sauerei zu verhindern, darin besteht, den Milchtopf schnellstens vom Herd zu nehmen. Doch diese Praxiserfahrung scheint im Berliner Senat nicht mehr vorhanden zu sein, und falls doch, gelingt es offenbar nicht, die in jedem Problemlösungsprozess hilfreiche Orientierung an Analogien aus anderen Lebensbereichen oder aus Prozessen der Natur zu nutzen.
Wie sieht die Realität des Wohnungsmarktes in Berlin aus?
Wie sieht der Topf aus, in dem die Mieten aufwallen?
Das sind schlicht die Grenzen des Einzugsgebietes von Berlin. Dieses Einzugsgebiet wächst sowohl mit der Attraktivität der Stadt überhaupt, als auch mit dem Angebot an Arbeitsgelegenheiten und Entwicklungs- und Karrierechancen. Es gibt noch weitere Kriterien, doch die weisen alle in die gleiche Richtung. Diese Grenzen lassen sich nicht beliebig weit ins Umland verschieben, weil mit dem Wachsen der Distanz zwischen Wohnort und dem quirligen Zentrum, der Nutzen, im Topf zu sein, rapide schwindet. Der Prozess des Zuzugs in die Stadt (und ihr näheres Umland) führt zwangsläufig zu einer Verdichtung und zu einer wachsenden Konkurrenz um den begrenzten (Wohn-)Raum, was diesen Raum in den Augen der Nachfrager nach Wohnraum so lange wertvoller macht, wie der Mietpreis den Mehrertrag des Wohnens in der Stadt nicht aufzehrt.
Die „Mietpreisexplosion“ ist Folge der „Nachfrage-Explosion“
bei nicht adäquatem Wachstum des Angebots.
Dass die Anbieter die Gebote der zahlungskräftigen Nachfrager annehmen und zusätzlichen Wohnraum für diese zahlungskräftige Nachfrage durch Neubau und Luxussanierung schaffen, ist eine natürliche Reaktion des Marktes, die durch nichts zu beheben ist, außer
- durch die Minderung der Attraktivität der Stadt, was trotz aller Bemühungen (kein Hauptstadt-Flughafen, Antifa-Hochburg, halboffizieller Ausweis von Standplätzen für Drogendealer in städtischen Parks, etc.) einfach nicht gelingt,
- oder durch Erweiterung des Angebots an Wohnraum bis zum Angebotsüberhang.
Den weiteren Anstieg der Mieten durch einen Deckel begrenzen zu wollen, steigert die Attraktivität der Stadt für alle Einkommensklassen, weil eben niedrige und höchste Mieten gleichermaßen eingefroren werden und daher von den nachdrängenden Interessenten bezahlt werden können, während die Mieten im Umland, außerhalb des landesgesetzlichen Einflussbereiches Berlins, noch stärker steigen werden als bisher und sich den Deckelmieten in der City annähern. Dies führt letztlich zu einer noch prekäreren Situation auf dem Mietmarkt.
Die gleiche Wirkung entfaltet der per Vorkaufsrecht mit erheblichem Aufwand durchgesetzte Ankauf von Mietshäusern durch die Stadt, der es den Altmietern ermöglicht, zu erschwinglichen, nur leicht erhöhten Mieten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Das ist zwar „sozial“ aber nur für die wenigen Nutznießer auch von Vorteil. Für das gesamte Mietgefüge in der Hauptstadt ist diese Maßnahme aber praktisch bedeutungslos. Hier werden Steuergelder wie der Tropfen auf dem heißen Stein sinnlos verdampft, wie auch alle Mietzuschüsse und Wohngeldzahlungen an Hartz-IV-Empfänger lediglich die Rendite-Erwartungen der Vermieter und Investoren befriedigen, aber keinen einzigen Quadratmeter Wohnraum schaffen.
Die Schnaps-Idee von Kevin-Kühnert, Wohnungsgesellschaften zu enteignen, ist, selbst wenn man die horrenden Entschädigungsleistungen außer Acht ließe, ebenfalls nur geeignet, die Attraktivität der Stadt gerade für die nicht ganz so zahlungskräftigen Nachfrager zu erhöhen. Alleine die vermutete Chance, eventuell doch eine solche Senatswohnung zu ergattern, wird immer noch mehr Menschen nach Berlin locken und dem Herd, auf dem der Milchtopf steht, neue Energie zuführen.
Erst wenn die Stadt für Zuzugswillige nicht mehr attraktiv ist, wird sich der Markt wieder stabilisieren.
Steigende Mieten tragen zu dieser Stabilisierung bei. Alle Maßnahmen, diesen Anstieg durch Preisregulierungen und durch Subventionen an die Mieter, die ja nur an die Investoren durchgereicht werden, zu bremsen, sind kontraproduktiv, weil sie die Attraktivität der Stadt erhöhen und den Zuzug nicht bremsen.
Möglichkeiten, die Stadt über die hohen Mieten hinaus weniger attraktiv zu machen, gäbe es durchaus auch, doch keine davon würde ich ernsthaft und guten Gewissens empfehlen wollen.