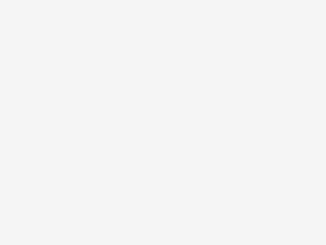Wie Sie wahrscheinlich schon entdeckt haben, schreibe ich seit zehn Jahren alle zwei Monate das Dossier „EWK – Zur Lage“.
Aus gegebenen Anlass enthält der heutige Tageskommentar nichts weiter als den Anfang der Ausgabe vom 28. November letzten Jahres.
Heute Nacht scheint die Welt das kapiert zu haben, was ich darin schon vor sieben Monaten prognostiziert habe. Zumindest die eine, Joe Biden betreffende Hälfte.
| EWK – Zur Lage
Stand 28. November 2023
Zeit der losen Enden Verlängerungskabel, soweit sie lose herumliegen, neigen dazu, sich heillos zu verwirren. Alles was an diesem Knäuel noch sicher zu erkennen ist, sind die beiden losen Enden. Nicht zielführend ist es, gleichzeitig den Weg beider in das Knäuel mündender Enden verfolgen zu wollen. Das schafft nur noch mehr Verwirrung. Man muss sich für eine Seite entscheiden, von der aus man das Fiasko betrachtet und sich die Mühe machen, das ausgewählte Ende so lange durch Schlaufen und Schleifen zu ziehen, bis der Weg von Stecker zu Buchse, von Anfang bis Ende, wieder geradlinig verfolgt werden kann. Bei der Betrachtung des aktuellen Zeitgeschehens ist mir, als ob die Welt voll loser Enden wäre, und hinter tausend losen Enden keine Welt. Ich werde dieses Bild in den folgenden Ausführungen hin und wieder verwenden. Sie werden allerdings erkennen, von welchem Ende her ich versuche, die Verwirrungen zu durchdringen, und dass es mir nicht in jedem Fall gelungen ist, heute schon beim anderen Ende anzukommen. Es sieht aber auch nicht so aus, als würde sich auch nur eine der Verwicklungen in diesem Jahr noch von selbst auflösen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon einmal eine entspannte Advents- und Weihnachtszeit. Mit besten Grüßen Ihr Egon W. Kreutzer
Welt USA
Die USA schlittern mit wachsender Geschwindigkeit in ihre nächste große Casting-Show, um die Rolle des Präsidenten für die nächste Amtsperiode zu besetzen. Das Angebot der ernsthaft in Frage kommenden Kandidaten ist derzeit noch absolut überschaubar, denn außer dem angeschlagenen Schlachtross Joe Biden und seinem Erzfeind Donald Trump hätte, wenn die beiden bis zum Wahltag überleben, niemand eine Chance. Das Überleben beider ist jedoch keinesfalls sicher.
Außer der Joe Biden wohlgesonnenen Presse und den Wahlkampfstrategen der Demokraten gibt es wohl niemanden, der noch ernsthaft daran glauben machen will, dass es tatsächlich Sleepy Joe sei, der in den USA die Macht des Präsidenten in Händen hält. Ein Mann, der ohne Teleprompter, Spickzettel und achtsame Helfer offenbar kaum mehr in der Lage ist, einen geraden Satz zu artikulieren, der aber dennoch von den Regierungen auf der ganzen Welt ernst genommen wird, weil sie wissen, dass ein Angriff auf dieses Sprachrohr von jenen, die die Texte vorgeben, sehr übel genommen werden könnte, ist einerseits ein sehr bequemer Präsident, weil er von der Machtfülle, die ihm die Verfassung zugesteht, selbst keinen Gebrauch macht, sondern sie längst in weiten Teilen an andere abgetreten hat, die kein Interesse daran haben, in der Rolle des Präsidenten in Erscheinung zu treten. Das Problem sind die Wähler. Die jüngsten Umfragen in den Swing-States, also jenen US-Bundesstaaten mit wechselnden Parteipräferenzen, dürften die Strategen in der Parteizentrale der Demokraten beunruhigen. In Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania liegt Donald Trump mit vier, fünf, fünf, sechs und elf Prozentpunkten deutlich vor Joe Biden, der nach Stand der Umfragen von Oktober und November 2023 nur noch Wisconsin mit einem Vorsprung von gerade noch 2 Punkten für sich entscheiden könnte. Bei den Wahlen 2020 gingen diese sechs Staaten alle an Biden und entschieden damit die Wahl. Dass daran nur das gebrochene Wahlversprechen schuld sei: „Keine neuen Bohrungen nach Öl und Gas auf staatlichem Boden“, das mit der Genehmigung für Conoco an drei Standorten in Alaska nach Öl zu bohren obsolet wurde, kann ich mir nicht vorstellen. Dies hat der Fokus wohl nur ins Blatt gehoben, um den deutschen Grünen einen Gefallen zu tun. Stärker ins Gewicht fallen dürfte die Tatsache, dass die US-Wirtschaft – trotz des teuren „Inflation Reduction Act“ Programms der Biden Regierung – in Stagnation übergegangen ist. Die Unternehmen bauen, erstmals seit 2020, wieder Stellen ab. Noch entscheidender für die Abwendung von Biden dürfte es für viele Amerikaner gewesen sein, dass der auch dieses Jahr wieder drohende Shutdown nur abgewendet werden konnte, weil die Republikaner erreichen konnten, dass im Übergangsetat, der bis in den Februar 2024 halten soll, keinerlei Mittel für die Unterstützung der Ukraine und Israels aufgenommen wurden. Hier ist Joe Biden als klarer Verlierer aus dem alljährlichen Ritual um die US-Schuldenbremse hervorgegangen, und Verlierer mögen die Amis nun einmal nicht so sehr. Selbst wenn es so sein sollte, dass es Demokraten gerade recht gekommen ist, den Beginn des Rückzugs aus dem Ukraine-Engagement aufgrund einer Haushaltssperre nicht selbst verantworten zu müssen, wenn also alles nichts als ein kluger Schachzug war, um eine geostrategische Frontbereinigung zu ermöglichen: Der Makel des Verlierers haftet Joe Biden an – und wird sein Standing im Wahlkampf und an den Urnen beeinträchtigen. Von daher gehe ich davon aus, dass der Kandidat der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen 2024 nicht Joe Biden heißen wird. Allerdings gilt auch hier: „Wer sich zuerst bewegt, verliert“, so dass der am Ende zur Wahl stehende Kandidat der Demokraten noch nicht zu erkennen ist. Auf der anderen Seite hält sich Donald Trump immer noch in der Pole Position bei den Republikanern. Er ist nun einmal eine Mischung aus Zugpferd und Zirkuspferd und bietet ganzjährig beste Unterhaltung. Eines darf jedoch nicht vergessen werden. Auch wenn Trump bereits vier Jahre im Weißen Haus hinter sich hat: Er gehört auch weiterhin nicht wirklich dazu. Der Umgang der US-Medien ähnelt dem der deutschen Medien mit Bernd Höcke und ist gekennzeichnet von äußerster Respektlosigkeit und Boshaftigkeit. Hinzu kommen die Besonderheiten der Justiz in den Vereinigten Staaten. Wo Millionenklagen auf Schadensersatz angenommen werden, weil es versäumt wurde, die Dümmsten der Dummen darauf hinzuweisen, dass Schnittblumen nicht zum Verzehr bestimmt sind und es sich bei Kaffee um ein Heißgetränk handelt, das durchaus auch einmal heiß serviert werden kann, sind obskure Anklagen und ebensolche Urteile eher ein Publikumsvergnügen, wie die Gladiatorenkämpfe im alten Rom, bei denen es am Ende einzig darauf ankommt, ob der Richter den Daumen hebt oder senkt. Es darf also nicht verwundern, dass Donald Trump inzwischen mehr Anklagen am Hals hat als lebende Verwandte. Besonders bizarr die Anklage in der Sache Stormy Daniels. Das sicherlich ausgesprochen glaubhafte Porno-Sternchen wollte eine Affäre mit Trump öffentlich machen, die Trump jedoch bestreitet. Dennoch zahlte Trump ein Schweigegeld, um die Sache aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Nun ist Trump angeklagt, gleich 34 Mal Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um die Zahlungen zu vertuschen. Alleine dieses „34 Mal“ ist ein Witz, nur dazu angetan, die Schuld, wenn es überhaupt eine gibt, besonders groß erscheinen zu lassen. Auch das Verleumdungs-Verleumdungs-Verleumdungs-Klagen-Ping-Pong, um E. Jean Carroll, die Trump 1996 in einem Kaufhaus vergewaltigt haben soll, wie Jean Caroll zufällig 23 Jahre später wieder eingefallen war, könnte hilfreich sein, das chronisch prüde Kleinstadt-Klientel der Wahlkämpfer davon abzubringen, ihr Kreuz bei Trump zu machen. In einem weiteren Prozess geht es darum, dass Trump vorgeworfen wird, den Umfang der Vermögenswerte seines Unternehmens stets an die gerade anstehenden Herausforderungen anzupassen. Banken gegenüber soll er sich rechnerisch reicher gemacht haben, um an günstige Kredite zu kommen, dem Finanzamt gegenüber soll er sich arm gerechnet haben, um seine Steuerlast zu minimieren. Ein Schaden ist daraus niemand entstanden. Außerdem steht es Banken immer frei, angebotene Sicherheiten zu überprüfen, wie es auch dem Finanzamt frei steht, die Angaben in Steueranmeldungen genauer anzusehen, bevor ein Steuerbescheid ergeht. Dann die Sache mit den Geheimdokumenten in Mar-a-Lago. Was bei Biden, mit den Geheimunterlagen in der Garage, keinen Staatsanwalt aus dem Winterschlaf weckte, hat bei Trump gereicht, um eine medienwirksame Hausdurchsuchung zu zelebrieren. Dann der angeblich von Trump angezettelte „Sturm auf das Kapitol“ und eine Reihe weiterer Verfahren, in denen Trump vorgeworfen wird, eine Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden angezettelt zu haben.
Alle diese Verfahren stehen im Ruch, weder der Wahrheitsfindung noch der Gerechtigkeit zu dienen, sondern ausschließlich dazu, Trumps Chancen bei der Präsidentschaftswahl zu torpedieren. Die Ankündigungen alleine, obwohl sie medial nach allen Regeln der Kunst abgefeiert wurden, haben Trumps Beliebtheit bisher nicht geschadet. Was im Zuge der Verhandlungen von der Klägerseite noch an schmutziger Wäsche auf dem Richtertisch ausgebreitet werden wird, ist noch nicht abzusehen. Doch Trumps Reputation wird während des gesamten Wahlkampfs von Gericht zu Gericht weitergezerrt, und die Hoffnung, dass von allem Schmutz am Ende, selbst wenn Trump in allen Fällen freigesprochen werden sollte, doch genug kleben bleiben werde, ist nicht unberechtigt. Trump versucht also noch einmal, den wütenden Bullen zu reiten, doch auch er ist seit dem Rennen um seinen ersten Sieg acht Jahre älter geworden, was auch manchen Wähler nachdenklich machen könnte. So ist es nicht verwunderlich, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, seinen Hut bereits mit Nachdruck in den Ring geworfen hat. Er hat nach meiner Einschätzung die besten Chancen, als Kandidat der Republikaner aus den Vorwahlen hervorzugehen, sollte Trump in den nächsten Monaten noch massiv beschädigt werden. Alle weiteren Kandidaten sind nicht der Rede wert. Auch wenn es bis zu den Wahlen in den USA noch ein Jahr hin ist, die aktuellen Entwicklungen geben Anlass, hier den ersten Anlauf zu einer Langfristprognose zu wagen. Trump erste Amtszeit war eine spektakuläre Episode in der US-Außen- und Kriegspolitik. Trump hat in vier Jahren keinen einzigen Krieg begonnen, sondern versucht, die Wertschöpfung der US-Volkswirtschaft zu steigern und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Während er China den Wirtschaftskrieg erklärte, suchte er zugleich den Interessenausgleich mit Russland traf sich sogar mit Kim Jong Un. Den von Obama eingefädelten Atom-Deal mit dem Iran hat er neu zur Disposition gestellt und die Rolle Israels im Nahen Osten durch diplomatische Offensiven bei den arabischen Nachbarn gestärkt.
Seine Strategie hieß „Deal“, nicht Konfrontation. Seine Druckmittel setzte er sparsam, aber wirkungsvoll ein, weil die Auswege, die er angeboten hat, durchweg gangbar erschienen.
Diese Schilderung der positiven Entwicklungen, die Trump in die Wege geleitet hat, mag manchem zu rosig erscheinen, doch muss sie in Erinnerungen gerufen werden, um die unaufhörlichen Angriffe und Attacken gegen Trump zu verstehen, denen er vor, während und nach seiner Amtszeit bis heute ausgesetzt war und ist. Das alles lief den Interessen jener entgegen, die sich als die Machteliten der USA verstehen und gewohnt waren, hinter den für das Publikum inszenierten politischen Schaukämpfen in Ruhe und zum gegenseitigen Vorteil ihren Geschäften nachgehen zu können. Ich sehe darin auch eine Erklärung dafür, dass man eine so schwache Figur wie Joe Biden ins Oval Office gesetzt hat, denn was man zur Revision der Trump’schen Entscheidungen absolut nicht brauchen konnte, wäre ein Präsident gewesen, der – aus welchen Gründen auch immer – mit eigenen Ideen und Strategien in Erscheinung getreten wäre. Weil die vier Jahre Trump und die nachfolgenden vier Jahre Biden für die Machteliten insgesamt acht verlorene Jahre waren, nämlich vier Jahre, in denen sie wuterfüllt dem Treiben Trumps zusehen mussten, ohne ihm Einhalt gebieten zu können, und vier Jahre, die es dauerte, um die Entwicklungen, die Trump auf den Weg gebracht hatte zu revidieren, werden diesmal wirklich alle Mittel eingesetzt werden, um eine neuerliche Präsidentschaft Trumps zu verhindern. Meine erste Prognose, die ich mir vorbehalte, im Laufe der Zeit noch zu revidieren, sieht so aus: Biden wird seine Amtszeit nicht regulär beenden. Am wahrscheinlichsten ist eine Art „Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen“. Während Kamala Harris die Amtsgeschäfte übernimmt, werden die Demokraten einen neuen Kandidaten vorstellen und medial so weit aufbauen, wie immer das möglich ist, einschließlich unglaublicher Zustimmungswerte in den Umfragen, die jeden Zweifel an einer regulären Stimmenauszählung dieses Mal schon im Vorhinein ersticken werden. Zugleich wird versucht werden, die Wählerschaft der Republikaner massiv zu beeinflussen, um DeSantis im Vorwahlkampf eine echte Chance gegen Trump einzuräumen und das Zugpferd der Republikaner damit entscheidend zu schwächen. Gelingt dies, ist die Welt schon wieder in Ordnung. Wird Trump dennoch nominiert, werden erneut die bewährten und inzwischen sicherlich noch optimierten Methoden zum Einsatz gebracht. Vor diesem Hintergrund halte ich eine zweite Präsidentschaft Trumps für ebenso unwahrscheinlich, wie eine zweite Amtszeit Bidens.
Russland – Ukraine
Seit Beginn der „militärischen Sonderoperation“ im Februar letzten Jahres fällt mir an der Berichterstattung von Russia Today (RT) ein sich schleichend fortsetzender Trend auf: Die Erfolgsmeldungen werden spärlicher, sind in weniger heroische Worte gekleidet und werden manchmal auch nur als Zitate der ukrainischen Medien erwähnt. Bei der Auswahl der Meldungen halten sich Berichte über zivile Opfer ukrainischen Beschusses im Donbass und Berichte über erfolgreich abgewehrte ukrainische Angriffe ungefähr die Waage. Über russische Erfolge im Bodenkampf und dabei erzielte Geländegewinne wird eher zurückhaltend berichtet. Es kommt mir so vor, als wolle RT seine westliche Klientel mit seiner Berichterstattung eher langweilen, das Interesse einschläfern, die Dinge ihren Gang gehen lassen, ohne ihnen besondere Bedeutung beizumessen … |
Ähnliche Aussagen zu aktuellen Entwicklungen gibt es alle zwei Monate in Form des Dossiers „EWK – Zur Lage„