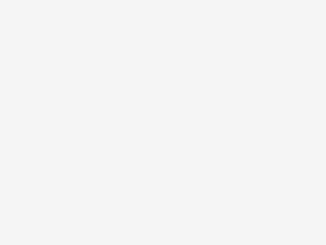Gelesen, nicht selbst gesehen, habe ich von der jüngsten Runde bei Markus Lanz, in der es um die Frage der Arbeitsmoral derjenigen ging, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, also zwischen 15 und 25 Jahren alt sind.
Da es keine definierte Abgrenzung für das früheste und späteste Geburtsdatum einer (herbeifantasierten) Generation Z gibt, können auch etwas Ältere und etwas Jüngere gemeint sein. Sicher ist aber, dass kaum jemand darunter ist, der tatsächlich schon überhaupt eine schwerwiegende Verantwortung auf sich genommen hat.
Was soll also die Diskussion darüber, wie sich diese jungen Leute das ideale Leben vorstellen? Ist doch klar. Die sind mehr oder minder frisch aus Schule und Studium gekommen, lebten die längste Zeit bei den Eltern, etliche wohl immer noch, kennen aus ihrem Leben in Kindheit und Jugend ein Überangebot an freier Zeit, stellen dann fest, wenn sie ihre Eltern betrachten, dass deren Jugendträume sich nicht erfüllt haben, und wollen es für sich besser machen, also weniger arbeiten und mehr Zeit für sich und für sich und für sich – und natürlich auch genug – bis mehr als genug – Geld, um die Freizeit auch anders als mit dem kostenlosen Spaziergang im Park wieder auffüllen zu können.
Ich bin nicht überzeugt, dass dies – erstens – die Einstellung der Mehrzahl der Angehörigen dieser Generation Z ist (ist das „Z“ nicht eigentlich verboten?), und – zweitens – dass sich diese Einstellung kaum noch finden lassen wird, wenn diese Generation zur Altersgruppe der 35- bis 45-Jährigen zählen wird.
Auch wenn nur die Wenigsten sich dann klargemacht haben werden, dass der Kern des „arbeitsteiligen Wirtschaftens“ die Arbeit ist, ohne die „Wirtschaften“ überhaupt nicht möglich wäre, werden sie doch zumindest über den Preis der Dinge festgestellt haben, dass ihr eigener Lebensstandard vom Ertrag ihrer Arbeit abhängt.
Arbeit ist nun aber einmal der Einsatz von Lebenszeit um Dinge zu schaffen oder Dienstleistungen zu erbringen. Bricht man den Gedanken bis auf den Grund herunter, dann sind die Teilnahme am Wertschöpfungsprozess und die Teilhabe am Konsum ein Vorgang, bei dem Lebenszeit gegen Lebenszeit getauscht wird.
Wer wenig eigene Lebenszeit einsetzen will, wird daher auch nur geringe Anteile der Lebenszeit anderer eintauschen können.
Selbstverständlich spielen dabei auch Faktoren wie „Qualifikation“, „Effizienz“ und „Angebot und Nachfrage“ eine Rolle, so dass die Lebenszeit unterschiedlich gewichtet und bewertet wird, doch auf vergleichbarem Level ist es der Einatz von Zeit, der den Ertrag bestimmt.
Dass „Effizienz“ und „Qualität“ (als Ergebnis von Qualifikation) auch durch Kapital hergestellt werden können, soll hier ausgeklammert werden. Auch in der Generation Z wird der weit überwiegende Anteil seine Arbeitsleistung in Form abhängiger Beschäftigung erbringen und den Kapitaleinsatz nicht beeinflussen können.
Es muss nicht ausgeführt werden, dass ein Beschäftigter, der pro Woche fünf Tage zu acht Stunden arbeitet um 25 Prozent mehr „herstellt“ als derjenige, der nur vier Tage pro Woche arbeitet, was bedeutet, dass Letzterer auch mit einem um 20 Prozent niedrigerem (Brutto-) Lohn zufrieden sein muss. Das sind aber individuelle Entscheidungen, die jeder für sich treffen soll und kann, solange sie sich in einem eingependelten Systemzustand immer wieder ausgleichen.
Es muss aber ausgeführt werden, was die Verschiebung der Lebenszeit von der Arbeitszeit zur Freizeit mit einer Volkswirtschaft anstellt.
Beginnen wir ganz klein beim Grundnahrungsmittel Brot. Alle Brotbäcker reduzieren ihre Arbeitszeit um 20 Prozent. Das Ergebnis: Das Angebot an Brot geht um 20 Prozent zurück. Sagen Sie jetzt nicht: „Dann sollen die Leute eben Kuchen essen!“, die Kuchenbäcker haben ihre Arbeitszeit nämlich ebenfalls um 20 Prozent verkürzt. Das gleiche gilt für Nudeln. Es gilt nicht für Reis, denn die asiatischen Reisbauern produzieren weiterhin die gleichen Mengen. Das Problem besteht nun allerdings darin, dass die Importe mit den Einnahmen aus den deutschen Exporten bezahlt werden müssen. Die deutschen Exporte sind wegen der generellen Einführung der Vier-Tage-Woche jedoch ebenfalls um 20 Prozent geschrumpft. Wir können also in diesem Fall nicht zusätzliche Mengen an Reis importieren, um das Brot zu substituieren, weil uns das Geld fehlt um den Reis zu bezahlen. Das betrifft aber nicht nur den gestiegenen Bedarf wegen des Brotmangels, es betrifft auch den Umfang unserer bisherigen Reisimporte.
Das Ergebnis:
Weil weniger Brot gebacken wird, kann auch nicht mehr so viel Reis importiert werden.
Über die gesamte Volkswirtschaft gesehen verändert sich eben nicht nur die abstrakte statistischen Größe BIP, es erfolgt eine sehr konkrete und schmerzhafte Absenkung des Lebensstandards.
Aber nicht nur, weil insgesamt weniger produziert wird. Da ist ja noch eine zweite Schiene.
Die Verknappung bei der Lebensmittelversorgung führt zu einem Bieterwettbewerb unter den Nachfragern. Das heißt: Brot, Kuchen, Nudeln und Reis werden teurer. Sie werden um so viel teurer, dass das Angebot eben noch abgenommen wird, also Markträumung erfolgt.
Damit fließen größere Teile des Einkommens der Konsumenten in die Lebensmittelbranche, womit anderen Branchen gleichzeitig Kaufkraft entzogen wird.
Es ist also nicht nur so, dass die Kaufkraft aller um jene 20 Prozent gesunken ist, die sich aus der Arbeitszeitverkürzung ergeben, sie verlagert sich auch zunehmend in Richtung der unverzichtbaren Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.
Damit entsteht eine Nachfrageschwäche die sich letztlich über alle Branchen ausbreitet und zum Beispiel den Absatz von E-Bikes stark reduziert, so dass aus der Arbeitszeitverkürzung zusätzliche Arbeitslosigkeit wegen Auftragsmangels entsteht.
Man könnte natürlich versuchen, die E-Bike-Monteure zu Bäckern umzuschulen, um an der Brotfront Entlastung zu schaffen.
Unterstellen wir, das könnte gelingen, dann gäbe es zwar wieder Brot für alle, aber eben keine E-Bikes mehr.
Weil es während der Pandemie in aller Munde war, noch das Beispiel vom anderen Ende der Nahrungskette: „Toilettenpapier“
Ein Produktionsrückgang um 20 Prozent würde innerhalb kürzester Zeit zu Kalamitäten führen. Importe wären alleine aus hygienischen Gründen umumgänglich. Zum Ausgleich der Handelsbilanz wären allerdings vermehrte Exporte erforderlich. Wir müssten also, weil die üblichen Produkte der Exportindustrie ebenfalls bereits stark reduziert sind, auf Dinge zurückgreifen, die bisher (auch) im Binnenmarkt abgesetzt wurden. Egal worum es sich handeln würde: Um einen erweiterten Exportmarkt zu erschließen, müssen die Preise im Export gesenkt werden, während weitere Produkte aus dem Binnenmarkt verschwinden oder zumindest erkennbar knapp werden.
Die ganz einfache Wahrheit hinter der Idee von der „Life Work Balance“ lautet: „Was nicht geschaffen wird, kann auch nicht konsumiert werden“, oder, aus der anderen Perspektive betrachtet: „Wohlstand erfordert Arbeit.“
Deshalb bin ich sicher, dass auch die Generation Z so lange die Leistung erbringen wird, die sich als notwendig herausstellt, um die eigenen Vorstellungen von einem guten Leben verwirklichen zu können, bis der Produktivitätsfortschritt mehr Freizeit ohne Wohlstandsverlust möglich macht.