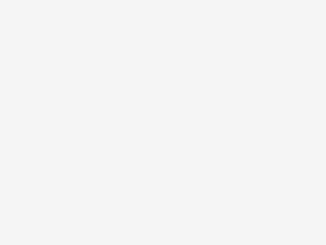PaD 41 / 2022 – Hier auch als PDF verfügbar: Pad 41 2022 Deutschlands tönerne Füße
Es ist nicht so, dass Ton, vor allem wenn er richtig gebrannt wurde, gar keine Stabilität aufweisen würde.
Es gab eine Zeit, da hat man in Deutschland – vor allem in Scheunen – die Zwischendecken aus etwa 60 Zentimeter langen, 20 Zentimeter breiten und nur wenige Zentimeter dicken „Ziegelsteinen“ hergestellt, die in eine tragende Konstruktion von parallel verlaufenden Doppel-U- oder Doppel-L-Eisen eingeschoben und dann mit einem dünnen Estrich bedeckt wurden. Ich habe daran eine lebhafte Erinnerung, weil eine solche Scheunenzwischendecke vor vielen Jahren unter mir nachgegeben hat und ich urplötzlich, links und rechts auf die Ellenbogen gestützt nur noch halb im Obergeschoss befindlich war, während meine Beine bis zur Hüfte im Untergeschoss von der Decke baumelten.
Es ist eben alles eine Frage der Alterung und der Belastung.
Dass wir Deutschen ein Problem mit der Alterung haben, ist hinlänglich bekannt. Natürlich ist es schön, dass unsere Lebenserwartung in den letzten 70 Jahren ziemlich kontinuierlich gestiegen ist, nur: Der Durchschnitt stimmt nicht mehr. Die Jugend, die in der Lage wäre, die Last noch zu tragen, ist nicht nachgewachsen. Von daher ist unsere Elastizität verschwunden und hat einer Versprödung Platz gemacht, die sich negativ auf die Stabilität auswirkt.
Zugleich sind die Belastungen gewachsen. Wir haben sie geradezu aufgehäuft, ohne zu prüfen, ob denn die ursprüngliche Tragfähigkeit unseres gemeinsamen Hauses überhaupt noch vorhanden ist. Brücken werden regelmäßig inspiziert. Gibt es Anlass für Bedenken, sollten eigentlich schnellstmöglich Maßnahmen zur Wiederherstellung der Standfestigkeit und Belastbarkeit ergriffen werden. Dummerweise ist es so, dass wir in Deutschland in unseren besten Jahren weit mehr Brücken neu in die Landschaft gestellt haben, als wir heute noch instandzuhalten in der Lage sind. Da stellen wir eben Schilder auf: „80 kmh – Brückenschäden“, und wenn ein paar Jahre ins Land gegangen sind heißt es dann: „30 kmh – Brückenschaden – Radarkontrolle!“. Noch ein paar Jahre später wird die Brücke gesperrt und der Verkehrsfunk hat ein neues Dauerthema unter den Staumeldungen.
Dabei ist das Beispiel von den maroden Brücken noch nicht einmal die Spitze des Eisberges. Grüne sind ja sowieso der Auffassung, dass Straßenbau – und folglich auch die Instandsetzung von Straßen – kontraproduktiv sei, weil die nur den Umstieg des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene verzögert. Das will ich hier aber nicht auswalzen, obwohl ich gerne darauf hinweise, dass weder die Schienen vorhanden sind, auf die umgestiegen werden könnte, noch das rollende Inventar der Bahn, das Güter und Personenverkehr aufnehmen könnte.
Nein. Lieber radikalisiere ich mich heute und gehe in den Untergrund, dorthin, wo die Wurzeln der Problematik aufzufinden sind.
An den Sockel der Wohlstandspyramide, der große Schnittmengen mit dem oberen Bereich der kopfstehenden Alterspyramide aufweist.
Dorthin, wo auch schon Bert Brecht geblickt hat, als er seine Dreigroschenoper mit dieser Weisheit enden ließ:
„Denn die einen sind im Dunkeln
Und die anderen sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte
Die im Dunkeln sieht man nicht. “
Schlaglichtartig und mit gespielter Empörung erhellen die Mainstreammedien hin und wieder jene finsteren Kellerlöcher des deutschen Hauses für einen Augenblick, in denen jene gesellschaftlichen Errungenschaften aufbewahrt werden, die als „die Tafeln“ und als „das Containern“, sowie als „der Kampf gegen die Retourenvernichtung“ und „die Forderung nach allgemeiner Reparierbarkeit“ bekannt sind.
Was dazu in die Welt gesetzt wird, ist eine Mischung aus abgrundtiefem, wirtschaftlichem Unverstand und dem immer noch erfolgreichen Versuch, jegliche tiefergehende Ursachenforschung elegant zu umschiffen.
Wer hätte denn 1993 daran denken können, dass aus dem Versuch des Vereins Berliner Frauen e.V. , die Situation der Berliner Obdachlosen zu verbessern, indem sie die erste „Tafel“ errichteten, nach nicht ganz 30 Jahren die größte soziale Bewegung der Gegenwart entstehen würde, die stolz ist, einen einheitlichen „Markenauftritt“ mit dem Namen „Tafel Deutschland e.V.“ geschaffen zu haben, wer hätte damals gedacht, dass heute 60.000 Aktivisten, oft zusammen mit ihren Lebenspartnern, die Ernährungsgrundlage von mehr als zwei Millionen „Kunden“ in Deutschland sicherstellen müssten?
Wer hätte vor fünf Jahren zu prognostizieren gewagt, dass die Tafeln heute selbst zu einem Sanierungsfall geworden sein werden?
Das Spiel geht nicht mehr auf.
Während immer mehr Menschen den Weg zur Tafel nehmen, um sich für lau mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, sah sich inzwischen ein Drittel der 960 in Deutschland agierenden Tafeln gezwungen, einen Aufnahmestopp zu verhängen, also keine „Neukunden“ mehr anzunehmen, obwohl die Abgabemengen pro Haushalt bereits reduziert wurden.
Das ist der Beginn einer neuen Zweiklassengesellschaft auf unterstem Niveau. Unter den Ärmsten behalten die Alt-Armen ihre Tafelberechtigung, während die Neu-Armen so lange nicht zum Zuge kommen, bis die Alt-Armen weggestorben sind.
Selbst wenn damit nun das Ausmaß der Armut in Deutschland bereits vollständig beschrieben wäre, wäre es eine Affenschande für dieses Land und ein Grund für jeden Politiker, der die deutsche Sozialpolitik lobt und Regelsatzerhöhungen, die von der Inflation schon aufgezehrt sind, noch bevor sie überhaupt zur Auszahlung kommen, als soziale Großtat verkauft, umgehend wegen des Gesichtsverlust der vor dem Spiegel der Realität unvermeidlich eintreten muss, per Seppuku (Harakiri ) aus dem Leben zu scheiden.
Aber so wenig sich sozial kalte Sozialpolitiker ihres Versagens bewusst sind, so wenig ist das Ausmaß der Armut mit den zwei Millionen Tafelkunden schon ausgelotet. Längst nicht alle, denen es materiell nicht besser geht als den Tafelkunden, haben überhaupt die Chance, eine der 960 Tafeln zu erreichen, und längst nicht alle, die als Armutsrentner, als Transferleistungsbezieher und als prekär Beschäftigte am Monatsende unfreiwillige Fastentage einlegen, können sich überwinden, ihre unantastbare Würde durch das Betteln um eine Tüte nicht mehr verkaufsfähiger Lebensmittel zu verlieren.
Meine persönliche Schätzung liegt bei etwa 8 Millionen in Deutschland lebender Menschen, die heilfroh wären, monatlich um die hundert Euro extra für Lebensmittel zur Verfügung zu haben. Nur drei Euro pro Tag. Eine Schachtel Zigaretten kostet, je nach Marke, inzwischen schon um die acht Euro.
So hat sich also ein Teil derjenigen, die nicht genug zum Essen haben, darauf spezialisiert, die Tafeln zu entlasten und stattdessen die Mülltonnen von Supermärkten zu plündern. Es sind eher die Jüngeren, die noch schnell genug weglaufen können, wenn der Wachmann um die Ecke kommt.
Deren Argumentation ist schlicht: Ihr habt die Sachen weggeworfen, also dürfen wir sie uns nehmen.
Die Frage, warum manchen Supermärkte manche Waren nicht von den Tafeln abholen lassen, obwohl dabei – und das ist das Schöne daran – keine Entsorgungskosten anfallen, sondern immer noch ihre teuren Müllcontainer füllen, ist sicherlich nicht in jedem Einzelfall zutreffend zu beantworten.
Grundsätzlich steht dahinter jedoch der Wunsch, den eigenen Umsatz einigermaßen stabil zu halten. Dazu braucht es zwei Voraussetzungen:
1. Es muss stets – und bis zum Ladenschluss – ein reiches Angebot aller Waren in den Regalen stehen, weil sonst die Kunden ausbleiben und lieber dahin gehen, wo es noch nach Schlaraffenland aussieht.
2. Waren, die nicht mehr verkaufsfähig sind, dürfen nicht auf einem zweiten Distributionsweg angeboten werden, der dem eigenen Laden mehr oder minder stark Konkurrenz macht.
Die erste, für den Handel in Friedenszeiten überlebenswichtige Voraussetzung, führt zwangsläufig dazu, dass Tag für Tag Artikel mit überschrittenem MHD aussortiert werden müssen.
Bei der zweiten Voraussetzung ist es etwas schwieriger, den Sachverhalt zu verstehen.
In gewisser Weise stehen die Tafeln in Konkurrenz zu den Märkten. Werden den Tafeln reichlich Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt, und darunter womöglich auch noch solche aus dem Hochpreissegment, gehen die Tafelkunden mit dicken Kartons nach Hause und haben am Ende so viel im Kühlschrank, dass sie auch noch an die gar nicht so bedürftigen Nachbarn, Freunde und Bekannten etwas abgeben und stolz verkünden: Das gibt es alles für lau bei der Tafel, Geh‘ doch auch mal hin.
Diese Entwicklung kann dazu führen, dass der Supermarkt in der nächsten Woche mehr Ware übrig behält als in der Vorwoche und den Abholern von der Tafel daher entsprechend mehr Ware in den Lieferwagen packen kann.
Wir stehen damit gedanklich am Beginn einer Spirale, an deren Ende der Supermarktleiter seinen gesamten Wareneinkauf bei der Tafel abliefert, während seine ehemaligen Kunden sich dort kostenlos bedienen.
Natürlich kommt es nicht so weit. Es wird vorsorglich genau darauf geachtet, was die Tafel bekommt – und wie sich das in der Folge im Verkauf auswirkt. Werden negative Wirkungen festgestellt, ändert sich das Verhalten. Weniger für die Tafel – mehr für den Container.
Nun ist die Armut im Lande aber nicht auf den Mangel der Bedürftigen an Lebensmitteln beschränkt. Kein Wunder, dass der Versandhandel und dessen Umgang mit den Retouren dabei Begehrlichkeiten weckt.
Niemand weiß wirklich genau, welche Anteile aus den Retouren unbesehen verschrottet werden, und welche noch einer Wiederverwendung zugeführt werden. Dass das Verschrotten für die große Mehrzahl der Produkte jedoch die für den Handel – und damit auch für die Kunden des Handels – die weitaus preiswerteste Lösung darstellt, ist sehr einfach zu belegen.
Üblicherweise liegt der Ware bereits ein Rücksendeschein bei, der vom Kunden als Porto-Beleg auf das Paket mit der Rücksendung geklebt wird. Der QR- oder Barcode auf diesem Rücksendeschein wird von der Warenanahme des Rücksendungslagers eingescannt, woraufhin im Auftragsbearbeitungssystem die Rücksendung als erfolgt verbucht und die Rückerstattung des Kaufpreises in die Wege geleitet wird. Das verursacht minimale Kosten und es ist nicht auszuschließen, dass kein Mitarbeiter das einzelne Paket dazu anzusehen oder anzufassen brauchte.
Wollte man mehr tun, als den Eingang feststellen und das Paket über Förderbänder in große Müllcontainer laufen zu lassen, wird die Angelegenheit sehr schnell sehr teuer.
Der Kunde hatte die Ware ja ausgepackt und an- bzw. ausprobiert, bevor er den Entschluss fasste, sie zurückzusenden. Damit ist in mehr als 99 Prozent der Fälle sicher, dass die Originalverpackung Schaden erlitten hat. Damit ist der Artikel als Neuware nicht mehr an den Mann zu bringen. Der Versuch würde nur eine erneute Rücksendung auslösen. Alleine um dies aber festzustellen, müsste das vom Kunden „irgendwie“, bloß nicht gut, verpackte Paket geöffnet werden. Das geht auf zwei Arten: schnell und rabiat, oder vor- und umsichtig. Schnell und rabiat vergrößert den Schaden, verringert jedoch die Personalkosten. Vor- und umsichtig ist zeitaufwändig und teuer, und führt doch nur zur gleichen Erkenntnis: Nicht mehr in verkaufsfähigem Zustand.
Der nette Nerd von nebenan könnte nun auf die Idee kommen, der Versandhändler könne sich ja vom Hersteller eine gewisse Anzahl an Originalverpackungen liefern lassen und den Originalzustand selbst wieder herstellen. Nur ein Optimist glaubt, dass eine ausgeklügelte Herstellerverpackung von einer angelernten Logistikkraft in der Retourenannahme des Händlers, die täglich mit den unterschiedlichsten Artikeln konfrontiert wird, auch nur annähernd genutzt werden kann, um die ausgepackte Retoure neu zu verpacken. Es geht nicht.
Soll nun aber ein zurückgesandter Artikel, von dem klar ist, dass er nicht mehr als Neuware verkauft werden kann, auch noch technisch geprüft werden, ob der vom Kunden genannte Reklamationsgrund zutrifft?
Auch das setzt Kenntnisse und Fähigkeiten voraus, die einfach nicht vorhanden sind und für die Fülle der Artikel auch nicht vorgehalten werden können. Selbst wenn diese Fähigkeiten und die Fachkräfte, die darüber verfügen, vorhanden wären, ist damit zu rechnen, dass die Überprüfung eines Fehlers viel Zeit kostet, wobei der Artikel noch weiterem Stress unterworfen wird, sodass er anschließend erst recht nicht mehr verkauft werden kann.
Aber darum geht es ja auch gar nicht. Der Wunsch ist, die Retouren, wie abgelaufene Lebensmittel bei den Tafeln, einfach abholen zu dürfen.
Wie stellen sich die Leute das vor? Sollen riesige Hallen voller Regale, sortiert nach Warenarten von den Händlern bestückt werden, damit die Interessenten durch die Gänge laufen und sich mitnehmen können, was sie wollen? Soll so ein Second-Hand-Supermarkt ohne Kasse auf Kosten des Händlers installiert werden? Und wie lange müsste die Retoure dann im Regal liegen bleiben, bis sie mangels Interesse doch entsorgt werden muss?
Nehmen wir einfach zur Kenntnis: Rücksendungen kosten Geld, nämlich den Einkaufspreis der Ware, die Versandkosten für die Lieferung und die Versandkosten für die Rücksendung, sowie ein paar Cent für die Registrierung der Retoure.
Dies Kosten sind kalkulatorisch im Preis der Neuware berücksichtigt.
Jeder weitere Aufwand, zu dem der Handel verpflichtet werden sollte, muss sich im ebenfalls in der Kalkulation und damit im Endpreis für den Kunden niederschlagen.
Nicht viel anders sieht es bei unverkäuflicher Neuware aus. Die muss irgendwann raus aus dem Lager. Sollte sich ein Ebay-Händler finden, der die Ladenhüter zum Ramschpreis abnimmt, dann ist es gut. Falls nicht, dann bleibt auch hier nur die Schrottpresse oder die thermische Verwertung.
Soll ich noch auf die Forderung nach „Reparierbarkeit“ eingehen? Ja?
O.K. Wenn so ein kleines Wunderwerk der Technik, in dem mehr Ingenieursgeist steckt, als der durchschnittliche Nutzer im ganzen Leben aufnehmen könnte, von weitgehend vollautomatischen Fertigungsstraßen mit hochpräzisen Maschinen zusammengesetzt wird, dann besteht am Ende das Ganze aus dem Gehäuse und einem hochkomplexen Innenleben aus vielleicht zwei oder drei noch trennbaren Funktionsblöcken, die unter Umständen noch ausgetauscht werden könnten – aber eben nicht vom Heimwerker am Wohnzimmertisch unter den wärmenden Strahlen der Stehlampe, sondern wieder nur von spezialisierten Fachbetrieben, und da kommt eben schnell zu den reinen Kosten des Ersatzteils auch noch der Stundenlohn des Elektronikers hinzu, so dass die Rechnung am Ende nahe unter, aber auch nahe über dem Neupreis des Gesamtgerätes liegen wird.
Solche Geräte, sei es ein Smartphone, ein Tablet oder ein moderner Fernseher, könnten zwar durchaus reparaturfreundlicher gestaltet werden. Das würde allerdings eine erhebliche Vergrößerung des Volumens und einen erheblich höheren Verkaufspreis mit sich bringen.
Aber was kann der Kunde mit einem Gerät, das in der Regel schon nach zwei drei Jahren technisch veraltet ist, überhaupt noch anfangen? Die Diskussion ist überflüssig wie ein Kropf, aber ihre Ursache zu diskutieren, ist wichtiger denn je.
Diese Ursache heißt Armut.
Armut ist nur in ganz seltenen Fällen die Folge eines leichtsinnigen, verschwenderischen Lebenswandels oder der Unwilligkeit, sich in in den Produktionsprozess einzubeziehen und durch Arbeit Geld zu verdienen. Häufiger, aber immer noch selten ist Armut dort zu finden, wo Krankheit und andere Schicksalsschläge die Erwerbsfähigkeit gemindert oder ganz zerstört haben. Für diese Fälle, nämlich die Fälle der unverschuldeten Not aufgrund persönlicher Schicksalschläge, wurden unsere Sozialsysteme errichtet, deren Grundgedanke das Versicherungssystem war, das sicherstellen sollte, dass viele Versicherte mit kleinen Beiträgen die notwendigen Leistungen für wenige „Schadensfälle“ bereitstellen. Wobei die Schadensfälle in Summe zwar mit statistischen Methoden ermittelt und vorhergesagt werden können, das Eintreffen und das Ausmaß des konkreten Einzelschadens jedoch nicht. Von daher bildet die so genannte Rentenversicherung eine Ausnahme. Das Erreichen des Rentenalters kann für die Mehrzahl der Bürger als gesichert gelten, auch die statistische Lebenserwartung ist hinlänglich gut bekannt, so dass der Begriff „Versicherung“ hier in die Irre führt.
Die Armutsgefahren aus unverschuldeter Not gab es immer. Die Systeme zur Verhinderung tatsächlicher Armut gab es in der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls. Sie funktionierten – grob eingeordnet – in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts am besten. Vorher waren die Systeme noch im Aufbau, danach wurden sie gleichzeitig überlastet und zurückgebaut.
Die eigentliche Ursache für eine weit verbreitete Armut in einer Bevölkerung findet sich jedoch in Mangelzuständen jeglicher Art. Ein Mangel an Lebensmitteln, an Bekleidung, an Wohnraum, an Schwimmbädern, Theatern, Bibliotheken, Kliniken, Schulen und Kindergärten kann jedoch mit Geld nicht behoben werden. Dafür braucht es eine funktionierende Landwirtschaft, es braucht eine funktionierende Textilindustrie, eine funktionierende Bauwirtschaft, es braucht Kulturschaffende, Ärzte und Pflegekräfte, Lehrkräfte, und wiederum eine industrielle Basis, die fähig ist, die notwendigen Geräte, Maschinen und Anlagen hervorzubringen. Obwohl es selbstverständlich ist, muss es in unserer von Wunschvorstellungen überwucherten Realität extra erwähnt werden, dass es ebenfalls Grund und Boden, Rohstoffe und Energie braucht, um dem Mangel, wo immer er auftritt, entgegenwirken zu können.
Wenn also ungefähr ein Zehntel der deutschen Bevölkerung in Armut lebt und weitere Millionen „armutsgefährdet“ sind, dann heißt das doch nichts anderes als, dass die deutsche Volkswirtschaft am Bedarf der Bevölkerung vorbei produziert und damit jenen Mangel schafft, der dafür sorgt, dass sich die Armut ausbreitet. Es heißt – weitergedacht – zugleich, dass die dürftige Alimentierung der Armen aus Steuermitteln und aus den Sozialkassen nur das Spiegelbild der Mangellage auf der Angebotsseite darstellt. Höhere nominale Transferleistungen in Form von Geld, denen kein höheres Angebot an Lebensmitteln, Bekleidung, Wohnraum, und so weiter gegenübersteht, vergrößern nur die Nachfrage und wirken damit preistreibend.
Am anschaulichsten lässt sich das am Wohnungsmarkt beobachten. Was auch immer der Staat an Zuschüssen an die Mieter zahlt, damit diese ihre Miete bezahlen können, es stützt und steigert nur die von den Vermietern erzielbaren Mieten. Dies funktioniert unweigerlich so lange, wie das Angebot an Wohnraum hinter dem Bedarf an Wohnraum zurückbleibt. Wobei jeder Versuch, die Mieten zu deckeln, einzufrieren oder gar staatlich festzusetzen, nur eine Verschärfung des Mangels nach sich zieht, weil sinkende Renditeerwartungen für einen Rückgang im Neubaubereich sorgen.
Damit ist der erste „tönerne Fuß“ Deutschlands, man könnte ihn den „linken Fuß“ nennen, soweit hinreichend beschrieben, dass es möglich wird, auch den zweiten, den rechten tönernen Fuß zu betrachten um dann deren Tragkraft zu der auf ihnen ruhenden Last ins Verhältnis zu setzen.
Der erste Augenschein lässt diesen zweiten Fuß als ausgesprochen stabil erscheinen. Es sieht so aus und wird so dargestellt, als sei gerade er jene Stütze, die den „Sozialstaat“ überhaupt erst ermöglicht und aufrecht erhält, die also den linken Fuß entlastet und das ganze Gebilde trägt.
Ich spreche vom Export, genauer gesagt, von der Exportlastigkeit der deutschen Volkswirtschaft.
Natürlich schafft die Exportwirtschaft Arbeitsplätze, natürlich ermöglicht der Export im Gegenzug den Import von Rohstoffen und Waren. Doch in der Konzentration auf den Export, der uns über Jahrzehnte den fragwürdigen Titel des Exportweltmeisters einbrachte, liegen zwei große Gefahrenpotentiale, die gar nicht überschätzt werden können, zumal ihre negativen Auswirkungen für jeden, der sie sehen will, längst die positiven Wirkungen übertreffen.
Um im internationalen Wettbewerb eine Spitzenposition einnehmen zu können,
haben wir bedenkenlos Arbeitslosigkeit importiert.
Die Absicht, in Deutschland den schönsten und größten Niedriglohnsektor aller Zeiten zu errichten, folgte einer relativ einfachen Strategie:
- Lohnkosten in Deutschland senken.
Neben der immer weiter fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung aller Produktions- und Verwaltungsprozesse in der Wirtschaft, durch die laufend Arbeitskräfte eingespart werden, bzw. Mehrproduktion ohne zusätzliche Arbeitskräfte möglich gemacht wird, wurde mit der Demontage der einstigen Arbeitslosenversicherung und ihrem Ersatz durch das Hartz-IV-System die Möglichkeit geschaffen, die Lohnnebenkosten, also die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken, und durch den Zwang zur Aufnahme jeder Arbeit, ohne störende Zumutbarkeitsregeln, ist es gelungen, Menschen mit bisher höheren Löhnen zu niedrigeren Löhnen wieder einzustellen. Dabei hat die drohende Zwangsverarmung durch enge Grenzen für den zulässigen Wohnraum und die zulässigen Rücklagen/Ersparnisse/Vermögen ganz erheblich beigetragen. - Lebenshaltungskosten in Deutschland senken
Um „Hungeraufstände“ aufgrund der niedrig gehaltenen, bzw. erst noch gesenkten Löhne zu vermeiden, hat sich die Volkswirtschaft damit beschäftigt, immer weitere Teile des Konsumartikelspektrums nicht mehr im Inland selbst herzustellen, sondern aus Billiglohnländern zu importieren. So sind ganze Branchen – von der Textilindustrie über die Spielwarenindustrie, die Haushaltswarenindustrie, die Hausgeräteindustrie bis hin zur Unterhaltungselektronik – in Deutschland ausgestorben, während andere Industrien, wie die Computertechnologie und die verwandte Kommunikationsnetze- und Gerätetechnologie nie über erste Anfänge hinaus gelangten. Im besten Fall ist es so, dass nur noch bekannte deutsche Markennamen auf Produkten prangen, die in China, Südkorea, Taiwan, in Ungarn, Tschechien oder Rumänien oder sonstwo auf der Welt produziert werden.
Die Strategie, die Bevölkerung mit im Ausland billig produzierten Konsumartikeln (und auch Lebensmitteln) zu versorgen, um deren Lohn- und Gehaltsforderungen auf das Maß begrenzen zu können, das dem Export nützt, im schlimmsten Fall nicht schadet, ist zunächst aufgegangen. Automobilindustrie und der damit eng verflochtene Maschinenbau, sowie die Chemie-Industrie konnten ihre Weltmarktpositionen ausbauen und in diesem Rumpfbereich der Industrielandschaft Arbeitsplätze in den Konzernen und bei deren Zulieferern schaffen, bzw. erhalten, während der Kahlschlag in den anderen Branchen dadurch kaschiert werden konnte, dass der wachsende Anteil des Versandhandels an der Distribution einen Boom bei den sogenannten Logistikunternehmen hervorbrachte, die wiederum für niedrigste Löhne eigene Angestellte in den überall aus dem Boden schießenden Verteilzentren und – vor allem auf der letzten Meile, von Haustür zu Haustür – (Schein-)Selbständige beschäftigten.
So lange sich die Bedürfnisse der Masse der Bevölkerung mit billigen Importen befriedigen ließen, geriet dieses Kartenhaus zwar hin und wieder ins Wanken, blieb aber – mit einer zusätzlichen Stütze hier und dem vorsorglichen Abriss gefährdeter Elemente – im Großen und Ganzen unbeschädigt stehen.
Jetzt stürzt es ein.
Der Strom der billigen Importe, bei dem sich stets aus dem Vollen schöpfen ließt, fließt nicht mehr im erforderlichen Volumen. Die im Zuge der Corona-Panik zerstörten Lieferketten, die im Zuge des Weltwirtschaftskrieges verhängten Sanktionen, die aufgrund einer visionären Energiepolitik eingeschränkten Kraftwerkskapazitäten und letztlich der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen extremen Einschränkungen beim Import von Gas, Öl und Kohle, sind der verheerende Doppelschlag gegen die beiden tönernen Füße auf denen unsere Volkswirtschaft bisher ruhte.
Die Verteuerung der Lebenshaltung, die auf einen Staat trifft, in dem ein Großteil der Haushalte ohne eigene Ersparnisse und sonstiges Vermögen anlegen zu können, bereits von der Hand in den Mund gelebt hat, führt dazu, dass aus der „gefühlten Armut“ einer Bevölkerung, der es im Vergleich zu Bangladesch oder Albanien immer noch gut geht, eine echte Armut wird, die schlecht und mangelhaft ernährte Menschen in unbeheizten Wohnungen sitzen lässt, ohne jede Chance – abgesehen von kriminellen Handlungen .- selbst noch etwas zur Verbesserung der Situation zu tun.
Die Verteuerung der Energie- und Chemierohstoffe führt gleichzeitig dazu, dass der industrielle Torso, der in Deutschland gehegt und gepflegt wurde, nicht mehr in der Lage ist, in Deutschland zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren. Die Fabriken ziehen entweder ab und lassen sich im Ausland da neu nieder, wo die Umstände ein wirtschaftliches Arbeiten noch ermöglichen, oder sie werden geschlossen. Wobei es volkswirtschaftlich betrachtet gleichgültig ist, ob der Schließung eine Insolvenz vorausgeht oder nicht.
Wie ist es aber mit dem vielbesungenem Mittelstand, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft? Wie ist es mit dem Handwerk und dessen goldenem Boden?
Der Mittelstand im verarbeitenden Gewerbe ist in weiten Teilen Zulieferer für die Industrie und das Handwerk. Die Industrie verliert gerade ihre Exportmärkte und das Handwerk verliert die Kundschaft.
Letzteres ist schon klar zu erkennen. Das Bauhandwerk ist zwar noch damit beschäftigt, den Rückstau von Aufträgen abzuarbeiten, der sich angesammelt hatte, doch im Neubausektor ist der einzige Zuwachs, den es noch gibt, nur bei den schnell ansteigenden Stornierungen von Bauaufträgen zu sehen. Daran hängen ja nicht nur die Maurer und die Ziegelbrennereien, die Zimmerleute und die Holzwirtschaft. Das gesamte Ausbaugewerbe, die Sanitär- und Elektro-Installateure, die Spengler, Fliesenleger und Maler, die Hersteller von Türen und Fenstern und Einbauküchen, nebst den Kühlschränken, Elektroherden und Spülmaschinen sind ebenso betroffen.
Was bleibt daneben noch Handwerk? Richtig: Die Kfz-Werkstätten.
Es mag sein, dass es hier noch einmal einen Boom im Reparatursektor geben wird, wenn sich das Durchschnittsalter der Flotte erhöht, weil Neuwagen für immer mehr Menschen zum unerschwinglichen Luxus geworden sind. Dagegen spricht allerdings die Verteuerung der Betriebskosten der Automobile durch immens gestiegene und voraussichtlich weiter steigende Kraftstoffpreise, was die Fahrleistungen halbieren und damit auch die Reparaturnotwendigkeiten reduzieren dürfte.
Auf mittlere Sicht kann der automobile Individualverkehr jedoch für viele Jahre nicht mehr jenes Ausmaß erreichen, dass die Beschäftigung des Kfz-Handwerks sicherte. Damit steckt dann auch der Tiefbausektor tiefer in der Krise. Straßenbau und Straßenreparaturen verlieren an Bedeutung und Dringlichkeit.
Die Illusion der Bundesregierung, das Land mit immer neuen Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe notdürftig am Leben zu erhalten bis wieder bessere Zeiten kommen, wird schon im nächsten Jahr wie eine Seifenblase zerplatzen.
Es wird keine gute Fee aus dem tiefen Tann kommen, die verspricht, drei Wünsche zu erfüllen. Es wird Zeit für den Kassensturz, für die Bestandsaufnahme.
Denn das Geld aus der massiven Kreditaufnahme wird nicht im Kreislauf der deutschen Realwirtschaft bleiben. Die von Lindner und Habeck unter der Oberaufsicht von Olaf Scholz geprägten Schuldentaler wandern nicht von einer Hand zur anderen, schon deshalb nicht, weil die geschlossenen, materiellen Transaktionsketten, denen der Taler folgen könnte, im deutschen Binnenmarkt nur noch in rudimentärer Form existieren. Alles was jetzt in die Wirtschaft gepumpt wird, egal ob als Hilfe für die Unternehmen oder als Hilfe für die privaten Haushalte, wandert entweder in die Kriegskassen der Energiespekulanten und in die Wirtschaftszonen der Ursprungsländer der Energieträger oder in die Wirtschaftszonen jener Exportländer, aus denen wir unsere Konsumgüter, Halbzeuge und Vorerzeugnisse beziehen. Nur der geringste Teil wird im Inland verbleiben, und auch der wird vermutlich sehr schnell mit der Tilgung von Krediten wieder aus dem Umlauf verschwinden.
Geld, so nützlich es ist um die Möglichkeiten des Handelns zu unterstützen, kann Arbeitsleistung nur bedingt und nur für kurze Zeit ersetzen, nämlich nur so lange und nur in dem Umfang, wie noch Ergebnisse der Arbeitsleistung zur Verfügung stehen, die damit bezahlt, bzw. entgolten werden können. Die jetzt angekündigten Schuldenpakete werden eingesetzt, um „fremde“ Märkte leerzukaufen. Das verstärkt die Knappheiten und führt unweigerlich zu steigenden Preisen. Das Geld, das jetzt aufgenommen wird, wird sich selbst entwerten, weil es nicht eingesetzt wird, um Werte zu schaffen, sondern nur, um vorhandene Werte zu verzehren.
Was jetzt benötigt wird, sind Investitionen in die Realwirtschaft. Genau in jene Branchen, die Deutschland bereits verlassen haben oder dabei sind abzuwandern. Zudem müssen die Ursachen für die Abwanderung beseitigt werden. Das bedeutet momentan in erster Linie auf die zügige Erschließung deutscher Energiereserven hinzuwirken, die in Form von Gas, Öl und Kohle vorliegen, statt das Land mit Windrädern zu überziehen, die den Energiebedarf weder kontinuierlich noch in der erforderlichen Kapazität befriedigen können.
Es ist hochgradig irreführend, wenn so getan wird, als sei Deutschland von nichts anderem abhängig als von russischem Gas! Es gilt, neue, geschlossene Wirtschaftskreisläufe zu installieren und damit das Leistungsvermögen Deutschlands auszuschöpfen, statt es, wegen eines Einkaufsvorteils bei ausländischen Produzenten, brachliegen zu lassen. Natürlich wird sich dabei das Verhältnis zwischen Löhnen und Preisen neu einpendeln müssen. Das kann schmerzhaft sein, und dieser Schmerz muss da abgemildert werden, wo es sich um unverschuldete Not handelt, aber er darf nicht gegen die Marktkräfte so abgemildert werden, dass sich der künftige Bürgergeldempfänger mit Nichtstun, auch ganz ohne Schwarzarbeit, unter dem Strich besser stellt als derjenige, der zum Prozess der Leistungserstellung beiträgt.
Wir brauchen Investitionen und ein politisches Klima, das Investitionen begünstigt, um die Wiederbelebung einer breit aufgestellten, bis auf unverzichtbare Rohstoffe grundsätzlich autarken Volkswirtschaft, zu erreichen, die dann auch fast automatisch wieder in den Zustand der Vollbeschäftigung übergehen wird.
Dabei aber darauf zu warten, dass noch ein Elon Musk daherkommt, Subventionen abgreift und eine Automobilfabrik in den märkischen Sand setzt, mit dem entscheidenden Hintergedanken, damit das über den Elektromotor hinausgehende Fachwissen und die Erfahrung der deutschen Automobilindustrie abgreifen zu können, ist ein Zeichen von Dummheit, das auch in einer Vielzahl von weiteren Fällen zu beobachten ist.
Ich breche hier ab. Der Aufsatz ist schon lang genug geworden. Vielleicht gibt es noch eine direkte Fortsetzung, Stoff dafür gäbe es genug.
Wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie mir, was Sie davon halten.