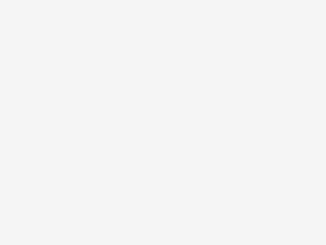Als am 1. September 2018 morgens um 5.09 Uhr viele der auf dem Raffieneriegelände der Bayern Oil in Vohburg verteilten Sensoren Gasalarm auslösten, war die Vorwarnzeit zu kurz.
Schon zwei Minuten später kam es zur Explosion eines Anlagenteiles im so genannten „Prozessfeld“. Feuerbälle schossen in den Himmel und eine gewaltige Druckwelle ließ die Fenster in der 13 Kilometer entfernten „Integrierten Leit Stelle“ (ILS) in Ingolstadt wackeln.
Auch zwei Monate nach der Havarie der Raffinerie ist die Ursache des Unfallgeschehens noch vollständig unklar.
Wenn ich mich ganz naiv stelle, dann komme ich zu dem Schluss, dass es ein großes Leck an einer unter Druck stehenden Leitung oder einem unter Druck stehenden Behälter gegeben haben muss, aus dem sehr schnell große Mengen gasförmiger Stoffe entwichen, sich mit der Außenluft zu einem zündfähigen Gemisch vermengten, sich an der nächstbesten Zündquelle entzündeten und explosionsartig verbrannten.
An jeder Waschmaschine, die auf sich hält, ist eine kleine Vorrichtung montiert, die sicherstellt, dass bei einer Fehlfunktion, vor allem aber bei einem geplatzten Schlauch, die Wasserzufuhr direkt an der Zapfstelle unterbrochen wird. Aqua-Stop heißt das Ding und ist weit mehr Verkaufsargument als tatsächlich hilfreich, denn Schäden, die per Aqua-Stop verhindert werden könnten, sind viel zu selten als dass der Aufand der Ausrüstung aller Waschmaschinen mit dem Aqua-Stop sich tatsächlich rentieren könnte.
Das weiß natürlich die einzelne schwäbische Hausfrau nicht, die sich lieber mit einem Aufpreis von 20 bis 200 Euro vor dem Risiko der Überschwemmung schützt und alle sechs bis acht Jahre mit der planmäßig defekten Waschmaschine auch einen keineswegs defekten Aqua-Stop entsorgt.
Die Konstrukteure von großtechnischen Anlagen wissen es.
Tausende von Leitungen automatisch zu schließen, wenn ein Druckabfall festgestellt wird, macht die ganze Anlage nur noch viel komplizierter und unbeherrschbarer und außerdem viel zu teuer. Das lassen wir lieber bleiben.
Die stattdessen eingesetzten Gassensoren, die ganz bestimmt in einer Leitwarte kleine rote LEDs zum Flackern brachten, was nachträglich aus dem Computer-Logbuch der Anlage ausgelesen werden konnte, halfen in diesem Fall auch nicht weiter.
Um 6.07 Uhr, also fast eine Stunde nach der ersten Explosion, meldet die Einsatzleitung vor Ort an die ILS: „Unkontrollierter Austritt von Benzin und Gas“.
In Rain am Lech, 50 km von Vohburg entfernt und in Donauwörth, 60 km von Vohburg entfernt, werden von Sensoren Explosionen gemeldet und im Umkreis von 20 km um die Havarie springen automatische Brandmeldeanlagen an.
Ob die Ansprechempfindlichkeit der Sensoren im weiten Umland falsch eingestellt war, sei dahingestellt. Fest steht, dass durch eine ganze Reihe von Fehlalarmen zusätzliche Unruhe ausgelöst wurde und Einsatzkräfte gebunden wurden.
Nüchtern betrachtet hat die Überwachung der havarierten Anlage nicht so funktioniert, dass der Schaden hätte vermieden werden können, während die Überwachung vieler Anlagen im großen Umkreis zu einer ganzen Reihe von Fehlalarmen führte.
Hier der Bericht aus der lokalen Presse.
Dies korrespondiert sehr gut mit dem Ergebnis des Tests der Gesichtserkennungssoftware am Berliner Südkreuz, wo Bundespolizei und die Deutsche Bahn AG über viele Monate hinweg testeten, ob Gesichtserkennungssoftware die Gesichter der Testpersonen erkennt oder nicht. Öffentlich bejubelt wurde dabei die hohe Treffergenauigkeit von 80 Prozent und die niedrige Zahl von Fehlalarmen von nur 0,1 Prozent.
Kritische Geister haben diese relativen Angaben in absolute Werte übersetzt – und da heißt es dann, bei einer bundesweiten Verfügbarkeit der Systeme an allen Bahnhöfen sei mit täglich 11.980 Alarmen zu rechnen, weil vermeintlich ein gesuchter Gefährder erkannt worden sei.
Wollte man all diesen „Verdachtsfällen“ mit einer Personenkontrolle nachgehen, müssten jährlich ungefähr 4 Millionen Einsätze zur Überprüfung der Erkenntnisse der Gesichtserkennungssoftware erfolgen, was – grob gerechnet und ohne Berücksichtigung der bürokratischen Aufwände – der Netto-Dienstzeit von etwa 2.200 Streifenpolizisten entspricht, die vermutlich in 90 Prozent der Fälle den Verdächtigen nicht mehr antreffen würden, weil der ja nicht im Bahnhof wohnt, sondern sich nur nach der Ankunft oder vor der Abfahrt kurz dort aufhält, Und unter jenen, die noch angetroffen werden, könnte dann jeder hundertfünfzigste tatsächlich ein Treffer sein
Lesen Sie dazu diesen Artikel bei achtgut.com.
Zugegeben, ich kenne mich mit dem Betrieb von Raffinerien nicht aus. Ich weiß nur, dass hier gigantische Chemiefabriken fast gänzlich ohne menschliches Personal betrieben werden.
Kleine Bahnhöfe meiner Jugend, die heute allenfalls noch über einen meist defekten Fahrkartenautomaten verfügen, hatten damals einen Bahnhofsvorsteher, eine Person für das Stellen der Weichen und die Bedienung der Schranken, einen Fahrkartenverkäufer, einen Gepäckannehmer und -ausgeber, einen Fahrkartenkontrolleur am Durchgang zum Bahnsteig. Dazu kam einer, der vor der Abfahrt kontrollierte, ob die Türen geschlossen waren und dem Lokführer mit der Trillerpfeife das Signal zum Losfahren gab. Hinzu kam das Bahnhofsrestaurant mit kalten und warmen Speisen vom Koch aus der Küche und dem Bier vom Fass, das vom korrekt gekleideten und frisierten Ober serviert wurde, sowie für die Reisenden der zweiten und dritten Klasse der Kiosk draußen, vor dem Bahnhof.
Ich vermute, dass auch Ölraffinierien damals mit mehr Personal betrieben wurden als heute.
Ich vermute, dass damals ein statt Sensoren und Servo-Motoren in der Raffinerie beschäftigter Mitarbeiter – womöglich unter Einsatz seines Lebens – nach dem Auftreten des Gaslecks ganz schnell ein großes Ventil geschlossen hätte, um das Unglück zu verhindern.
Es geht mir nicht darum, in einem Anfall von Nostalgie eine „gute alte Zeit“ an die Wand zu malen. Die hat es so nicht gegeben, die gute alte Zeit.
Allerdings gab es in den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts noch wirkliche Vollbeschäftigung, mit Jobs, von denen man durchaus leben konnte, ohne aufstockende Leistungen in Anspruch nehmen zu müssen, auch die Kleinstädte hatten noch lebendige Innenstädte, die Arbeitszeiten wurden eingehalten und Überstunden wurden bezahlt, es gab noch keine Pisa-Studie, aber engagierte Lehrer und überwiegend wissbegierige Schüler, man konnte noch bei einer Versicherung anrufen und von der ersten Minute an mit einem Menschen sprechen …
Betrachtet man die damaligen Personalzahlen der Unternehmen in Relation zu ihren Umsätzen, dann fragt man sich schon, wie die denn damals überhaupt wirtschaften konnten, wo doch heute viele viel „schlankere“ Unternehmen nicht mehr über die Runden kommen.
Das gilt auch für die öffentlichen Verwaltungen. So ein Rathaus, das strotzte vor Leben, vom Pförtner bis zur Zweitsekretärin des Bürgermeisters – wie konnten die das damals bezahlen, wo man zugleich auch noch reihenweise Schwimmbäder und Straßen baute, und das ohne sich bis unters Dach zu verschulden?
Dabei sollte man die Frage besser anders herum stellen.
Man muss sich doch fragen, wie heutzutage Unternehmen überhaupt noch überleben können, wo doch immer weniger Menschen gute Arbeit haben und dafür guten Lohn bekommen, so dass auch immer weniger Menschen noch genug Geld haben, um sich nach der Miete und dem Handy auch noch ein Feierabendbier leisten zu können.
Apropos Feierabendbier. Da sieht man es besonders deutlich. 1960 gab es pro 100 Einwohner mindestens einen gastronomischen Betrieb, und das auch in der Fläche. Heute liegt das Verhältnis bei 1:500 und die Dorfwirtschaften auf dem flachen Land sind alle weg, bis auf die wenigen, die sich als Ausflugsgaststätten über Wasser halten konnten.
Damals hatte auch noch jedes Dorf seinen Polizisten.
Unsere Gesellschaft hat, wo immer es nur möglich schien, Personalkosten durch Kapitalkosten ersetzt, Menschen durch Investitionen in Maschinen, Apparate, Computer und Roboter.
Diese kaufen, das wusste schon Henry Ford, allerdings keine Autos und sie setzen sich auch nicht zum Feierabendbier in die Kneipe.
Dass trotz dieser vielen „Blechidioten“ in Produktion und Verwaltung die offizielle Zahl der Arbeitslosen jetzt gerade wieder mit unter 5 Prozent angegeben werden kann, liegt nur daran, dass Mensch und Maschine längst nicht mehr nur für den eigenen Bedarf produzieren, auch nicht für den eigenen Überfluss, sondern zu Niedrigstlöhnen für den Export!
Bedenke: Jeder Euro Exportüberschuss ist Reingewinn in den Kassen der Exportwirtschaft – und damit die Steuern vom Gewinn niedrig bleiben, müssen die teuren Polizisten aus Fleisch und Blut gegen Videokameras mit Gesichtserkennungssoftware ausgetauscht werden, müssen Anlagenfahrer in der Petrochemie durch Sensoren ersetzt werden, darf der Bürgermeister am PC seine Protokolle selber tippen, statt zwei Sekretärilnnen zu beschäftigen – und nun beginnt gerade die Ablösung der Lkw- und Bus-Fahrer durch selbstfahrende Lkws und Busse. Das macht, trotz der miserablen Bezahlung der Fahrer, alleine auf den Lkw-Verkehr in Deutschland bezogen, eine Personalkostenersparnis und damit einen Netto-Gewinn von rund 25 Milliarden Euro jährlich aus.
Noch gigantischer die Ersparnis, wenn das Bargeld erst abgeschafft ist und an den Kassen im gesamten Einzelhandel nur noch Scanner und RFID Chips den Bezahlvorgang abwickeln.
Ja. Wir können uns jetzt viel mehr und in viel besserer Qualität leisten.
Wenn ich an meinen Großvater denke, der in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nie auf die Idee gekommen wäre, die Wände seiner Wohnung selbst zu tapezieren, obwohl er selbst auch nur einer von den so genannten „kleinen Leuten“ war, weil die Rechnung des Malers und Tapezierers noch nicht unbezahlbar hoch war, und wenn ich dann mit meinem Eimer Ultra-wer-weiß-wie-weiß-Weiß für 60 Euro vom Baumarkt nach Hause ziehe, um meine „Freizeit“ damit zu verbringen, die ewige Raufaser ein weiteres Mal neu anzustreichen, dann kommen mir daran erhebliche Zweifel.
Zumal mein Großvater auch seine Hosen noch vom Schneider anfertigen lassen konnte …