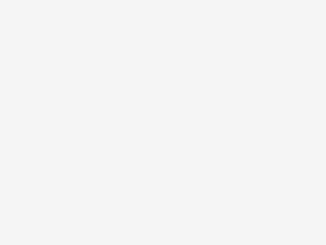Dass es um Deutschland nicht in jeder Beziehung zum Besten steht, war schon vor Ausbruch der Pandemie zu erkennen. Doch Corona hat den Nebeneffekt, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit nur noch auf zwei Aspekte konzentriert, nämlich Gesundheitswesen und Grundrechtseinschränkungen.
Obwohl diese Konzentration wichtig ist, soll auch an das erinnert werden, was darüber aus dem Blickwinkel geraten ist. Denn die allgemeine Zustimmung zu den Seuchenpräventions-Maßnahmen der Regierung, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Demokratie in Deutschland schon länger schwer beschädigt und auf Rituale reduziert dahinsiecht und sich zu einer Demokratie im Endzustand gewandelt hat.
Die Liste der Symptome ist lang und reicht von A – wie Antifa, Arbeitslosigkeit und Armut bis Z – wie Zampano.
Eines oder zwei dieser Stichworte werde ich in den nächsten Tagen fortlaufend etwas ausführlicher behandeln und jeweils für zwei Tage online lassen. Ich nehme an, dass das als Tagesration vollkommen reicht und vor allem niemanden vor der Masse des Textes zurückschrecken lässt. Immerhin handelt es sich in der Originalveröffentlichung um 75 Druckseiten.
Allen hier nach und nach vorgestellten Einzelpunkten ist die Frage voranzustellen , wie es in einer funktionierenden Demokratie dazu kommen kann, dass im wirtschaftlich stärksten und reichsten Land der EU, das mit massiven Außenhandelsüberschüssen glänzt, keine Mehrheit der Demokraten zustande kommt, die es übernimmt, die geschilderten Missstände zu beseitigen.
Rente und Altersvorsorge
In einer funktionierenden Volkswirtschaft mit einer einigermaßen ausgeglichenen Handelsbilanz steht in jeder Periode zum Konsum nur das zur Verfügung, was produziert wurde.
Ideal wäre es, wenn die Summe der Löhne und Gehälter und sonstigen Einkommen in jeder Periode auch wieder ausgegeben würde.
Diesem Ideal ist die umlagefinanzierte Rente sehr nahe. Aus den Einkommen der aktiv Beschäftigten wird ein Anteil einbehalten und praktisch ohne Zeitverzug den Rentnern für deren Konsum zur Verfügung gestellt. Es ist also sichergestellt, dass die für die Abnahme der Produktion erforderliche Kaufkraft im Markt bleibt.
Wie gut es den Menschen in einer Volkswirtschaft geht, hängt primär davon ab, wie produktiv die Volkswirtschaft insgesamt ist. Die Aufteilung der Einkommen auf Rentner und Beschäftigte ist Sache einer gesamtgesellschaftlichen Vereinbarung, bei der auch die Jüngeren bedenken, dass auch sie im Alter selbst auf Rentenleistungen angewiesen sein werden.
Dieses im Grund perfekte System wird von der Regierung sabotiert. Die umlagefinanzierte Rente soll nur noch eine Grundsicherung bieten, für den Rest ihres Bedarfs im Alter sollen die Beschäftigten durch Einzahlungen in eine kapitalgedeckte Rente sorgen. Das Kapital erhielten sie dann im Alter mit Zinsen zurück.
Was passiert?
In der Einzahlungsphase werden der Konsumnachfrage Mittel entzogen, die von den privaten Geldsammelstellen in Staatsanleihen, Aktien, Immobilien und was noch immer angelegt werden.
Der behauptete Ausgleich durch Auszahlungen an Rentner, die den gleichzeitig geleisteten Einzahlungen der Beschäftigten entsprechen, findet – wenn alles gut geht – erst nach einer langen Übergangsphase statt.
Bis dahin werden entweder Überschüsse produziert, die im Binnenmarkt mangels Kaufkraft nicht abgesetzt werden können, was den allgemeinen Wohlstand senkt, oder die Produktion wird zurückgefahren, was den allgemeinen Wohlstand durch wachsende Arbeitslosigkeit ebenfalls senkt und damit automatisch auch die Einzahlungen ins System der privaten kapitalgedeckten Rente reduziert.
In der Auszahlungsphase, Jahrzehnte später, gilt immer noch, dass nur das konsumiert werden kann, was auch produziert wird.
Ist das Angebot dann eher gering, was gleichzeitig eine geringe Kaufkraft der Lohnempfänger mit sich bringt, kaufen die Rentner mit ihrem Angesparten den Markt leer, weil sie bereit und in der Lage sind, höhere Preise zu bezahlen.
Ist das Angebot dann eher groß und sind auch die Löhne entsprechend hoch, könnten die Einkommen der Rentner nicht ausreichen, um die inflationsbedingten Preissteigerungen auszugleichen.
Beide Fälle stellen immer noch Idealfälle dar, denn Kapitalanlagen über lange Fristen sind stets mit Unsicherheiten behaftet, die im Extremfall zum Totalverlust des angesparten Kapitals führen können.
Es ist also töricht, die umlagefinanzierte Rente zu Gunsten der kapitalgedeckten Rente zu sabotieren.
Genau das geschieht aber. Den Vorteil haben nicht die Beitragszahler, nicht die Rentner, sondern einerseits die Arbeitgeber, deren Anteil am Rentenbeitrag bei niedrig gehaltenen Beitragssätzen niedrig bleibt, und jene Unternehmen, denen über Jahrzehnte die Sparleistungen der Beschäftigen zufließen um damit an den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen und an ihre Aktionäre auszuschütten, während den Rentnern bestenfalls die zugesicherten Rentenzahlungen überwiesen werden, im schlimmsten Fall aber gar nichts.
Vernünftige Demokraten müssten dieses Spiel ablehnen und die umlagefinanzierte Rente vor allen Gelüsten der Finanzindustrie schützen.
Das Gegenteil ist der Fall.
Offenbar habe ich mein Buch, „Der Goldesel“, bisher in der Werbung nicht so dargestellt, dass Sie Lust darauf bekommen hätten.
Es ist mit dem Eigenlob auch nicht so einfach. Fremde Bücher zu rezensieren fällt mir leichter, und wenn es angemessen ist, kommt darin auch einmal ein Superlativ vor. Doch könte ich das eigene Werk als „eine Mischung aus John Grishams packender Spannung und Thomas Manns Erzählkunst“ anpreisen, ohne dabei rot zu werden? Nein. Das geht nicht. Was geht, ist der Versuch, Ihnen aus den ersten Seiten des Romans einige Appetitthäppchen anzubieten. Vielleicht weckt das die Lust auf mehr …
Stimmung 1
Als das Fahrwerk der Alitalia-Maschine kurz vor 17.00 Uhr MEZ mit leichtem Rumpeln im Flugzeugrumpf einrastete und die Landschaft um Erding, die während der engen Linkskurve unmittelbar nach dem Start für ein paar Sekunden die Kabinenfenster auf der linken Seite völlig ausgefüllt hatte, plötzlich nach unten wegkippte und die Sicht in ein makelloses Himmelsblau freigab, öffnete Fred den Sitzgurt und lehnte sich zufrieden im bequemen First-class-Sessel zurück. Die Stewardess, die mit dem Erlöschen der Anschnallzeichen ihren Platz verlassen hatte, um sich um ihre Passagiere zu kümmern, kam mit professionell strahlendem Blick auf ihn zu, doch noch bevor sie ihre Frage an ihn richten konnte, ließ er sie mit dem Anflug eines Lächelns und einem kaum wahrnehmbaren Kopfschütteln wissen, dass er jetzt noch keinen Wunsch hätte. Daraus sprach mehr als nur die gelangweilte Routine des Vielfliegers. Schließlich gibt es viele Menschen, die mindestens ebenso viel in der Luft sind wie Fred, es aber nicht schaffen, sich jene lächerliche, kleinlich gierige Sucht bewusst zu machen, die sie zwingt, unmittelbar nach dem Start dem ersten Drink entgegenzufiebern, als hätten sie gerade eine lange Irrfahrt durch die flirrende Hitze einer Salzwüste überstanden.
Stimmung 2
Unten auf dem Rollfeld stand die überlange Limousine. Der Chauffeur, dem man offenbar ein Bild von ihm gegeben hatte, kam am Fuß der Gangway schnell auf ihn zu und sagte mit gedämpfter Stimme: „Willkommen, Signore Marohn, haben Sie Gepäck?“ Fred schüttelte den Kopf und stieg schnell ein. Das schwere, lange Gefährt glitt davon und verließ das Flughafengelände durch ein weit geöffnetes Tor in der Umzäunung. Nach wenigen Kilometern auf der fast leeren A29 tauchte der Wagen in den abenteuerlich ungezähmten Stadtverkehr von Palermo ein. Blendende Scheinwerfer, irritierende Leuchtreklamen, lautes aufgeregtes Hupen von allen Seiten, ständig unerwartete Fahrbahnwechsel – Fred war froh, dass man ihm einen Chauffeur geschickt hatte, der nicht nur über ausreichende Ortskenntnisse, sondern, was noch wichtiger war, auch über ausgezeichnete Erfahrungen im souveränen Umgang mit lästigen Verkehrsregeln verfügte. Er schaffte es, den kürzesten Weg durch das Straßengewirr der sizilianischen Hauptstadt zu nehmen und die Stadt nach knapp zwanzig Minuten auf der Autobahn in Richtung Messina wieder zu verlassen. Noch 60 Kilometer bis Cefalù, dachte Fred, als die Lichter Palermos hinter ihnen zurückblieben.
Hintergrund 1
Fred hob den Kopf und wartete kurz ab. Erst als Don Rimerco, der sich nach seiner Gesichtsmassage mit den Händen durch sein volles, silberglänzendes Haar fuhr, seinen Blick ebenfalls wieder fest auf den Vortragenden gerichtet hatte, zeigte Fred ein feines, fast schelmisches Lächeln, breitete die Arme mit offenen Handflächen nach oben aus, wie ein Clown, der resignierend vom Schlappseil steigt und erklärte mit einem gewinnenden, freundlich-fröhlichen Tonfall: „Sie haben völlig Recht, verehrter Don Rimerco, was ich Ihnen bisher so ausführlich geschildert habe, ist nichts als das trockene logistische Konzept, leblos wie ein bleiches Gerippe in den Katakomben von San Gennaro im gottverdammten Napoli.“
Don Rimerco gab das Lächeln zurück. „Der Junge beherrscht sein Handwerk“; dachte er und fühlte sich mit der Anspielung auf die frühchristliche Grabanlage im Hügel von Capodimonte zurückversetzt in eine Zeit, als er selbst noch darum rang, die Anerkennung des Paten von Palermo zu erringen. Er war es damals gewesen, der als junger Mann im Auftrag der Sizilianer vom Ätna zum Vesuv gezogen war, um in die Camorra einzutreten und dort – „undercover“ würde man heute sagen – für die Interessen der Sizilianer zu arbeiten. Er hatte damals das Treffen in der Catacombe di San Gennaro in die Wege geleitet. Hatte dafür gesorgt, dass die Chefs sechs verfeindeter Clans neben der Kirche Madre del Bon Consiglio den Eingang in die Unterwelt benutzten und er hatte dafür gesorgt, dass nach Ablauf einer vollen Stunde nur fünf von ihnen, diese allerdings untereinander versöhnt, wieder ans Tageslicht kamen. Carlo, damals Pate von Frascati, war für immer in den Katakomben zurückgeblieben und Pietro di Palermo, der Mann, der sich heute Don Rimerco nennen ließ, hatte sich mit dieser Tat mehr erworben, als nur das Anrecht auf eine gelegentliche Gefälligkeit.
Doppelmord
Wenige Augenblicke später knallten drei Schüsse durch das Haus. Die beiden ersten Projektile stammten aus Giuseppes Waffe. Sie trafen Isabella zuerst am linken Oberarm und dann einige Zentimeter weiter rechts. Mitten ins Herz. Der dritte Schuss kam aus der Waffe Pierre van Niems und traf Giuseppe von hinten in der Höhe des zweiten Halswirbels. Auch Giuseppe, der sich nach seiner Panikreaktion zu der sterbenden Isabella hinuntergebeugt hatte und in dieser Stellung aus nächster Nähe förmlich hingerichtet wurde, war sofort tot.
In der Villa Mari Luminosi herrschte unvermittelt eine hochexplosive Stimmung. Trotz aller Beteuerungen von Freundschaft und Partnerschaft war sich doch immer noch jeder selbst der Nächste geblieben, hatte jeder seine Vorbehalte, seine geheimen Absicherungen gegenüber jedem anderen, hatte jeder seine wohlgehüteten Geheimnisse bewahrt und trotz aller zur Schau gestellten, abgebrühten Gelassenheit hatte jeder Angst, denn das Doppelspiel eines Wachmannes, dem man viele Jahre lang sein Leben anvertraut hatte, war längst nicht lückenlos aufgeklärt.
Als die Signorina mitgeteilt hatte, was sie über die Kassette wusste, nämlich dass sie in der Videothek des Marco Branello, abgegeben werden sollte, war van Niem aufgesprungen. „Den schnappen wir uns!“
Josua
Wer sich einen alten, weißhaarigen, gebeugten Mann vorgestellt hatte, der wurde enttäuscht, denn der Prophet, der vorige Woche in Messina die Fähre verließ, um den Auserwählten auf der Insel des Lichts, wie Sizilien seit jeher genannt wird, die Verheißungen ihres Gottes zu verkünden, war gewiss nicht älter als 30 Jahre. Seine unregelmäßig-stoppelige Frisur über dem kugelrunden Gesicht verstärkte die Unruhe, die von seinen kleinen, stets aufmerksam bewegten Augen ausging. Mit einer kurzen, leicht nach oben gebogenen Nase und breiten, aber flachen und farblosen Lippen, die beim Reden zwei Reihen kleiner, weit auseinanderstehender Zähne freigaben, wirkte er auf den ersten Blick naiv, vielleicht sogar verwirrt. Der kleine speckig glänzende Rucksack, in dem er seine wenigen Habseligkeiten mit sich führte, gab ihm auch inmitten der größten Menschenmenge den Anschein erbarmungswürdiger Einsamkeit und verlieh ihm den Habitus des entsagungsvollen Eremiten. Seinen massigen, fetten Körper schnürte er in der Leibesmitte mit einem schmalen Ledergürtel ab, weil die große, an den Waden weit flatternde Jeans, von der er seit vielen Jahren untrennbar schien, nur mit Hilfe dieses Riemens in der richtigen Position gehalten werden konnte.
Eine groteske, lächerliche Figur, doch wundersamerweise ging von diesem immer schwitzenden, immer kurzatmig hechelnden Menschen, der sich kugelförmig durch die Welt wälzte, eine Faszination aus, der sich kaum jemand entziehen konnte. Wenn Joshua, wie er sich nennen ließ, einen Raum betrat, verstummten die Gespräche innerhalb kürzester Zeit. Wenn Joshua auf der Straße stehen blieb, sammelte sich bald eine Traube von Menschen um ihn, auch dann, wenn keiner derer, die da von seiner Ausstrahlung gebannt wurden, je von ihm gehört hatte.
Leidenschaft
„Hallo Fred.“ Unhörbar war sie hinter ihn getreten, hatte ihm die linke Hand um die Hüfte gelegt und presste sich fest an ihn, als er sich ihr zuwandte. „Ich habe jetzt nur eine Minute, aber in zwei, drei Wochen bin ich in München. Ich rufe dann ganz offiziell dein Büro an und bitte um einen Termin. O.k.?“
Als sie sich küssten, zuckte jener Blitz durch den Nachthimmel, der im gleichen Augenblick auch die auf dem Domplatz versammelte Menschenmenge erschaudern ließ. „Oh mein Gott!“ Fred spürte, wie Raizas Körper bei ihren geflüsterten Worten in höchster Erregung bebte und es hatte nicht viel gefehlt, dass er hier, auf unsicherem, ja höchst gefährlichem Terrain jegliche Kontrolle über sich verloren hätte. Doch noch bevor der Donnerschlag mit elementarer Gewalt die Fensterscheiben klirren ließ, hatte sich Raiza mit einem saften Ruck von ihm gelöst: „Wir sehen uns in München.“
Der Klang dieser Worte blieb in Freds Ohr und die Hitze der Berührung brannte noch lange auf seiner Haut, nachdem Raiza sich, genauso lautlos, wie sie erschienen war, wieder zurückgezogen hatte.
Vergewaltigung
Berta, sie hieß wirklich so, hatte jahrelang in der Kantine der KUPRE-Werke gearbeitet. Küchenhilfe. Einen Tag an der Ausgabe, einen Tag mitten in Bergen schmutzigen Geschirrs, dann wieder vormittags Salat portionieren und nachmittags den Küchenboden schruppen, ganz wie es den beiden Köchen gefiel. Berta war eine hübsche Frau, Ende zwanzig, und wie viele ihrer Kolleginnen dachte sie sich nichts dabei, wenn sie in der Hitze der Großküche unter dem weißen Kittel nicht mehr Wäsche trug, als einen winzigen Slip. Es kam, wie es kommen musste. Der ältere der beiden Köche lauerte ihr in einem Lagerraum auf. Zwischen den Regalen mit Konservendosen, Reissäcken und Ersatzgeschirr stieß er sie zu Boden. Ihre Gegenwehr blieb erfolglos. Er war viel zu stark und Berta kam es vor, als hätte er Erfahrung darin, einer Frau Gewalt anzutun, denn er schaffte es schnell, ihren Körper in eine Position zu zwingen, in der sie seiner Gier bewegungslos ausgeliefert war, während sich ihm der grob festgehaltene Körper der jungen Frau höchst vorteilhaft entgegenwölbte.
Berta hatte sich, kaum dass Herr Petterchen keuchend von ihr abgelassen hatte, ruckartig von ihm losgerissen und war losgerannt. Im Laufen hatte sie ihren Slip hochgezogen und den Kittel halbwegs ordentlich zurechtgezupft. Endlich im Bürogebäude, stürmte sie an der völlig überraschten Sekretärin vorbei direkt in das Büro von Dr. Mannhaidt, dem Personalchef, und verlangte, dass der Chefkoch bestraft und entlassen würde. Dr. Mannhaidt war es gelungen, die junge Frau zu beruhigen und dann hatte er ihr erklärt, dass das so einfach, wie sie sich das vorstelle, nicht sei. Schließlich gäbe es ja bisher nur ihre Behauptung und man müsse auch Herrn Petterchen hören und ob er ihn denn gleich dazurufen sollte. Dann werde man ja sehen, ob er es wagt, die Tat zu leugnen, wenn er dem Opfer dabei Auge in Auge gegenübersteht.
Berta, die noch viel zu aufgeregt war, um begreifen zu können, wie das Spiel laufen sollte, stimmte zu. Petterchen kam. In der makellos weißen Jacke mit den zwei Reihen schwarz-glänzender Knöpfe, die in elegantem Schwung nach oben auseinander liefen und die leichte Taillierung vorteilhaft unterstrichen, gekrönt von seiner hohen, weißen Kochmütze, war er eine tadellose Erscheinung. Berta, deren derangiertes Äußeres bis dahin noch als Beleg für die Wahrheit ihrer Schilderung gelten konnte, stand dagegen wie eine unordentliche Schlampe da. Als sie sich dessen bewusst wurde, begann sie, sich ihres Zustandes zu schämen und damit war ihre Glaubwürdigkeit endgültig dahin. Petterchens laute Empörung wirkte echt. Er stritt rundweg alles ab, nannte sich einen Ehrenmann und beschimpfte Berta als ‚undankbares Weib’. Immer hätte er ihr alles nachgesehen und das hätte sie nun frech und übermütig werden lassen, obwohl er sich immer noch nicht vorstellen könne, was sie sich davon verspreche, ihn so zu verleumden.
Dr. Mannhaidt zuckte mit den Schultern und sah Berta mit ausgesprochen kritischen Blicken an: „Ich denke, Sie haben schlechte Karten, junge Frau. Ich kenne Herrn Petterchen jetzt schon viele Jahre. Ich muss zugeben, dass ich ihm eine solche Tat von Anfang an nicht zugetraut habe, aber schließlich musste ich Ihren ungeheuerlichen Vorwürfen ja nachgehen. Jetzt steht hier Aussage gegen Aussage …“
Flucht
Emilios Boot war schnell und bot dem Steuermann ein Dach und Wetterschutz nach drei Seiten. Marco fand den Anlasser und er fand die richtigen Kabel, um den Motor auch ohne Schlüssel zu starten. Lärmend sprang der kräftige Diesel an und Marco verließ den Hafen, verließ Cefalù, verließ Sizilien, die Insel des Lichts, die ihrem Namen in dieser Stunde nicht gerecht wurde. Marco war ein Schönwetterkapitän, dem man auch schon einmal einen Wasserskifahrer anvertrauen konnte, aber der vom Sturm gepeitschten See war er kaum gewachsen. Er wusste allerdings, dass er das Boot, nachdem er den schützenden Hafen verlassen hatte, nicht einfach sich selbst überlassen durfte. Mit höchster Motorleistung kämpfte er gegen die Wellen an. Wie ein Korken wurde das leichte Boot meterhoch nach oben getragen um gleich darauf in das Wellental hinunterzustoßen. Serien schwerer Brecher stürzten über das Deck und nahmen dem Steuermann die Sicht, aber er und das Boot schafften es, die Nase oben zu behalten, bis der Sturm weitergezogen und das Tyrrhenische Meer mit leicht gekräuselter Oberfläche zur Ruhe gekommen war.
Marco stoppte den Diesel und ging unter Deck. Er war noch immer in Shorts und fror erbärmlich. Er hatte das dringende Bedürfnis sich aufzuwärmen, und außerdem wollte er baldmöglichst feststellen, wo er sich befand, damit er den Kurs festlegen und seine weiteren Chancen ausrechnen konnte. „Man wird Emilios Boot sehr bald vermissen. In drei oder vier Stunden wird es im Hafen lebendig. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand feststellt, dass sich Emilios Boot nicht einfach losgerissen hat.
Sie wollen mehr davon?
Dann klicken Sie den Goldesel an…