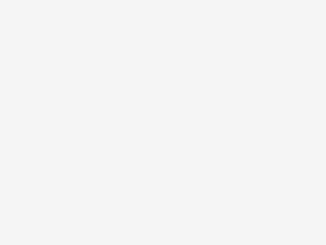Die alte Skat-Weisheit: „Mit vollen Hosen ist gut stinken“, bewahrheitet sich im Gekreische der Polit-Hysteriker unserer Tage wieder einmal in voller Schönheit.
Während die einen noch nicht damit fertig sind, so laut, wie Selenski nach Waffen, nach der Einrichtung öffentlicher Wärmehallen für den Winter zu verlangen, haben die anderen, kaum dass die Meteorlogen für die nächste Woche die vage Möglichkeit von Temperaturen um die 40 Grad Celsius ankündigten, schon begonnen, nach öffentlichen Abkühlhallen zu rufen.
Die Frage, wo diese Einrichtungen geschaffen werden sollen, und mit welchen Mitteln sie im Winter beheizt oder in der nächsten Woche gekühlt werden sollen, wird dabei vorsichtshalber gar nicht angesprochen. Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, und wo ein Wille ist, soll doch auch ein Weg zu finden sein, oder?
Mit den seit Anfang März in Deutschland angekommenen Flüchtligen aus der Ukraine – es sollen inzwischen um die 900.000 sein, so genau weiß man es auch wieder nicht – sind die Möglichkeiten der Kommunen, noch Platz für Wärmehallen für jeweils 5.000 Personen zu schaffen, vermutlich weitgehend ausgereizt. Alleine 146.000 ukrainische Kinder und Jugendliche sind bereits an deutschen Schulen angemeldet. Aus den Landkreisen hört man Hilferufe, wie hier stellvertretend im Bericht aus dem Landkreis Meiningen-Schmalkalden vom 10. Juli nachzulesen ist.
… und wenn das mit den Wärmehallen gelingen sollte, und auch dafür gesorgt wird, dass die Menschen während des Fußmarsches zur Wärmehalle nicht erfrieren: Wie man in ein paar Tagen, große Räumlichkeiten für das öffentliche Abkühlen finden, und dann auch noch die Kältemaschinen dafür beschaffen, installieren und in Betrieb nehmen soll, steht vollends in den Sternen.
Als ich vor zwei Jahren, im Sommer 2020, am Manuskript für meinen Polit-Thriller „Andere Abhilfe“ arbeitete, der im Zeitraum vom 17. November 2022 bis zum 1. Mai 2023 spielt, also gezwungen war, bestimmte Entwicklungen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation vorherzusehen, habe ich mich entschieden, einen Aspekt der dramatisch veränderten Situation mit dem Szenario eines frühen und sehr harten Wintereinbruch im Dezember 2022 darzustellen.
Dass der Winter 2022/23 weder früh noch mit besonderer Härte hereinbrechen muss, um katastrophale Folgen mit sich zu bringen, weil aufgrund politischer Entscheidungen entweder die Industrie stillgelegt werden muss oder die Heizungen in den Wohnungen kalt bleiben werden, habe ich – dummerweise – nicht vorhergesehen.
Lesen Sie einen Abschnitt aus „Andere Abhilfe“, nämlich die Seiten 132 bis 156 (von 315), die den Wintereinbruch und seine Folgen schildern.
Der Winter
Was die Modelle der Meteorlogen schon länger und mit wachsender Wahrscheinlichkeit prognostiziert hatten, traf Deutschland und die Nachbarländer in den ersten Dezembertagen mit voller Wucht. Drei Tage lang fielen in allen Höhenlagen dicke weiße Flocken aus einem dunkelgrau verhangenen Himmel. Dann war die sogenannten Omega-Lage da und die beteiligten Hoch- und Tiefdruckgebiete bewegten sich nicht von der Stelle. Eisige Luftmassen aus Sibirien hielten die Temperaturen tagsüber deutlich unter null, in den sternenklaren Nächten waren Temperaturen zwischen minus 20 und minus 30 Grad Celsius die Regel.
Der Winterdienst hatte dem starken Schneefall der ersten Tage nur wenig entgegenzusetzen, so dass der Dauerfrost die Schnee- und Matschdecke auf den Straßen und Gehwegen in den Städten ebenso wie auf den Landstraßen und Autobahnen in eine betonharte Eisschicht verwandelte. Im Freien geparkte Pkws mussten mühsam freigeschaufelt werden, und oft zeigte sich dann, dass die Mühe vergebens war, weil der Motor nicht mehr anspringen wollte. Auch die Bahn stand weitgehend still. Es wurde zwar fieberhaft versucht, durch Schneeverwehungen gesperrte Strecken freizuräumen und unter der Schnee- und Eislast gerissene Oberleitungen zu reparieren, doch gab es kaum noch Möglichkeiten überhaupt an die betroffenen Streckenabschnitte heranzukommen. Außerdem fehlte es überall am Personal, weil die Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze nicht erreichten. Am meisten traf es die Vorreiter der E-Mobilität. Die Kälte hatte die Kapazität der Batterien soweit reduziert, dass allenfalls noch Entfernungen von bis zu dreißig Kilometer gefahren werden konnten, ohne Gefahr zu laufen, auf freier Strecke stehen zu bleiben. Das Problem wurde noch dadurch verschärft, dass die meisten Ladesäulen wegen der andauernden Flaute und dem dadurch verursachten Totalausfall des Windstroms von den Netzbetreibern abgeschaltet wurden.
Auf die öffentlichen Verkehrsmittel, die schon länger nicht mehr fahrplanmäßig unterwegs waren, war mit dem Kälteeinbruch überhaupt kein Verlass mehr. Wer nicht unbedingt musste, blieb zuhause, hielt Fenster und Türen dicht geschlossen, und versuchte verzweifelt mit allen Mitteln gegen die Kälte anzuheizen.
Weite Teile der Wirtschaft kamen zum Erliegen, weil zu viele Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit erschienen oder weil die Stromkontingente, die den Betrieben zugeteilt wurden, nicht ausreichten, um die Produktion aufrecht zu erhalten.
Zu Beginn der dritten Woche verkündete Jörg Kachelmann, dass vermutlich noch nicht einmal die Hälfte der Kälteperiode überstanden sei. Die Bundesregierung rief den Notstand aus und verhängte eine absolute Ausgangssperre von jeweils 15.00 Uhr bis zum nächsten Tag 10.00 Uhr. Bundeswehr, Technisches Hilfswerk, Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste arbeiteten bis zur Erschöpfung daran, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Heizmaterialien zu sichern, während nach und nach eingefrorene Wasserleitungen dazu zwangen, irgendwie auch noch ausreichende Mengen Trinkwasser zu den Menschen zu bringen.
Arztpraxen, soweit sie noch geöffnet waren, und die Kliniken versorgten überwiegend Patienten mit schweren Erfrierungen, die oftmals Amputationen erforderlich machten.
 Die Mitglieder der Komiker waren von der Situation ebenso betroffen, wie der allergrößte Teil der Bevölkerung. Sie waren gezwungen, in ihren Wohnungen auszuharren und die Meldungen der lokalen Radiosender zu verfolgen, denn nur dort erfuhr man, welcher Supermarkt wann für ein paar Stunden öffnen würde, wenn eine neue Lebensmittellieferung eingetroffen war. An der wöchentlichen Telefonkonferenz hielt man zwar fest, doch außer sich gegenseitig zu versichern, dass man noch gesund sei und mit der Lage einigermaßen zurechtkomme, gab es nichts zu berichten.
Die Mitglieder der Komiker waren von der Situation ebenso betroffen, wie der allergrößte Teil der Bevölkerung. Sie waren gezwungen, in ihren Wohnungen auszuharren und die Meldungen der lokalen Radiosender zu verfolgen, denn nur dort erfuhr man, welcher Supermarkt wann für ein paar Stunden öffnen würde, wenn eine neue Lebensmittellieferung eingetroffen war. An der wöchentlichen Telefonkonferenz hielt man zwar fest, doch außer sich gegenseitig zu versichern, dass man noch gesund sei und mit der Lage einigermaßen zurechtkomme, gab es nichts zu berichten.
Für die Freien Siedler, die überall auf den Almhöhen vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land, im Vertrauen auf die unaufhaltsam fortschreitende Erderhitzung überzeugt waren, so etwas wie Winter, würde es nie wieder geben, war der Wintereinbruch das Todesurteil. Ohne jegliche Vorsorge für den Kälteeinbruch getroffen zu haben, waren sie der Naturkatastrophe schutzlos ausgeliefert. Nur wenige waren psychisch gesund und physisch kräftig genug, um sich aus dem tiefen Neuschnee, der ihre Hütten unter sich begraben hatte, herauszuarbeiten und den Weg ins Tal zu den ersten Höfen und Dörfern zurückzulegen. Hunderttausende kämpften vergeblich gegen die Kälte und erfroren da, wo sie erschöpft zusammengebrochen waren.
Die Krisenstäbe von Bayern und Baden-Württemberg mussten erste Rettungsversuche schnell wieder aufgeben. Als der Schneefall aufgehört hatte, scheiterten die für die Evakuierung vorgesehenen schweren LKWs bei dem Versuch, die tief verschneiten, schmalen Wirtschaftswege, die hinauf zu den Anhöhen der Siedlungsgebiete führten, zu befahren. Der Einsatz von Hubschraubern zur Rettung der Eingeschlossenen war bei der Masse der Menschen, die hätten geborgen werden müssen, von vornherein aussichtslos. Also beschränkte man sich darauf, Hilfsgüter per Helikopter nach oben zu schaffen und beim Rückflug jeweils ein paar Kranke und Verletzte mit ins Tal zu nehmen. Es dauerte jedoch nur eine Woche, bis sich in den so genannten Siedlungen keinerlei Leben mehr regte. Mehrere hunderttausend Menschen waren jämmerlich erfroren.
Weil die Gebiete nicht erreichbar waren und es zudem unmöglich erschien, schweres Gerät heranzuschaffen, mit dem im hartgefrorenen und felsigen Untergrund wenigstens Massengräber hätten ausgehoben werden können, wurden die Gebiete der Freien Siedler zu Sperrzonen erklärt und die steifgefrorenen Leichen einfach liegen gelassen. Erst mit Einsetzen des Frühjahrstauwetters würde man sie, bzw. was dann noch von ihnen übrig war, bergen können. Bis dahin fanden Füchse, Marder, Adler und Krähen und die schon länger von Osteuropa her eingewanderten Wolfsrudel dort eine willkommene und schier unerschöpfliche Nahrungsquelle.
Zum Jahreswechsel schlug das Wetter um. Das stabile Hoch über Mitteleuropa zog unter Abschwächung nach Osten ab. Milde Meeresluft vom Atlantik kam mit vielen Wolken in einer südöstlichen Strömung über das Land. Gefrierender Regen überzog Häuser, Straßen und Fahrzeuge mit einer dicken Eiskruste auf die anschließend wieder große Mengen Schnee fielen. Doch tagsüber erreichten die Temperaturen manchmal schon wieder fünf bis sieben Grad über null, und nachts wurde es kaum noch kälter als minus zehn Grad.
Wer diesen Dezember überlebt hatte, begann wieder Hoffnung zu schöpfen. Die Menschen kamen aus den Häusern, räumten auf, reparierten, was beschädigt worden war und erschienen wieder an ihren Arbeitsplätzen. Die Presse arbeitete massiv daran, eine neue Normalität zu verkünden. Schlagzeilen, wie: „Wir sind davongekommen!“, oder, „Der Winter ist besiegt“, wechselten sich mit heroischen Erfolgsmeldungen zu Reparaturarbeiten und dem Wiederanlaufen von Fabriken ab. Auch dass die Stromrationierungen nach der langen, fast windstillen Zeit teilweise wieder zurückgenommen werden konnten, wurde gefeiert, wie einst die Eröffnung des Suezkanals oder die Planerfüllung des VEB Plaste und Elaste in der DDR.
Geholfen hat es wenig. Das kurze Aufflackern von Freude und Lebensmut schlug bei der Masse der Bevölkerung schnell wieder in jenen Zustand von Apathie und Duldsamkeit um, der die verantwortungsbewussten und klar denkenden Immunen erneut entsetzte und Zorn hervorrief, aber eben auch den Mut und die Motivation mit sich brachte, den Kampf wieder aufzunehmen.
Doch auch die Verfechter der Neuen Weltordnung der Globalisten, und ihre allzu naiven und willfährigen Hilfstruppen blieben nicht untätig.
Berlin Siemensstadt
7. Februar 2023
Ingo Kolb benötigte heute kein Megaphon. Hatten sich vor zwei Monaten noch etwa zweihundert Aktivisten in der leeren Kabelwerkshalle versammelt, waren dem Aufruf auf Indymedia diesmal nur drei Dutzend Leute gefolgt. Es fiel auf, dass vor allem die Studenten fehlten. Womöglich hatten sie versucht, den „Jahrhundertwinter“, wie er jetzt schon offiziell hieß, bei ihren Eltern zu überstehen, wo für Heizung ebenso gesorgt war, wie für warme Mahlzeiten und überhaupt so manche Bequemlichkeit, während dieser Winter in den WGs in Berlin nichts anderes ermöglichte, als ödes Herumhocken in tristen, oft genug kalten Räumen, wo man sich doch schnell gegenseitig auf die Nerven ging. Weihnachten war ja auch noch, und die katastrophale Gesamtsituation ließ dann doch auch bei den hartgesottensten Straßenkämpfern die Sehnsucht nach so etwas wie Heimat, Familie, Sicherheit und Geborgenheit aufkommen. So oft man sich auch über die bourgeoisen Rituale und Gepflogenheiten als überkommene Gefühlsduselei empört hatte, die nur den Blick für die revolutionäre Situation und die Verbrechen des Schweinesystems verstellte: Ein einziger heftiger Schlag der Natur hatte genügt, um selbst wieder, gänzlich unreflektiert, den natürlichen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Zusammenlebens zu folgen und die Zuflucht bei der Familie zu suchen, die nach wie vor als Basis jeder höheren Organisationsform unverzichtbar ist, weil eine Gesellschaft, in der es keine familiären Bindungen mehr gibt, einfach zum Untergang in unerbittlicher Konkurrenz, jeder gegen jeden, verurteilt ist. Nur in der Familie können jene Verhaltensmuster erfahren und erlernt werden, die ein konfliktfreies Zusammenleben erst ermöglichen, beziehungsweise Möglichkeiten zur gewaltfreien Konfliktlösung erst eröffnen. Gerade das können Kitas, Tagesmütter, Kindergarten und Schule auch mit den raffiniertesten pädagogischen Mitteln nicht leisten, denn dort fehlt jenes Band zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern, das als Urvertrauen des Neugeborenen mit in die Welt kommt und nur durch grobe und nachhaltige Verletzungen zerrissen werden kann.
„Schön, dass wenigstens ihr gekommen seid“, sagte Ingo zur Begrüßung und verzog sein Gesicht zu einem schiefen, abfälligen Grinsen.
„Ist ja wohl nicht viel Staat zu machen, mit euch. Aber ich gebe nicht auf, bevor dieses Schweinesystem nicht besiegt ist, und ihr werdet auch nicht aufgeben, das weiß ich, das sehe ich euren entschlossenen Gesichtern an. Natürlich seid ihr enttäuscht, dass unsere hübsche Inszenierung vom letzten Jahr, nachdem sich alles so schön angelassen hatte und der Krieg gegen die Paläste schon in allen Städten in vollem Gange war, durch ein paar läppische Schneeflocken abgewürgt worden ist. Scheiße war das. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber, wie heißt es so schön: Was uns nicht umbringt, macht uns nur noch härter!
Nächstes Wochenende gibt es zwei wichtige Termine. Von Samstag auf Sonntag sind Verschönerungsaktionen angesagt. Ihr zieht in Zweiergruppen los – mehr ist jetzt einfach nicht drin. Einer sichert, einer malt. Sucht euch schon mal eure Partner aus, ich gebe jeder Gruppe jeweils drei Adressen, die nahe beieinander liegen und bequem in einer Nacht abgearbeitet werden können. Sprühdosen könnt ihr euch dann hier aussuchen. Sind alles Nazi- oder Bullenschweine. Schöne große Hakenkreuze sprühen, möglichst so, dass die dann auch von der Straße aus gut sichtbar sind. Wo es Gartenmauern gibt, sind die der Malgrund. Ich erwarte gute Arbeit. Die Fotodokumentation übernehme ich am Sonntagmorgen. Die Adressen sind innerhalb von zwei Stunden abgefahren. Kommst du mit mir, Rita und übernimmst das Fotografieren? Ich hol dich dann morgen Früh so gegen neun zuhause ab.
Nachdem das nun geklärt ist, die zweite wichtige Sache. Es ist wieder einmal „Bunkerstunde“ angesagt. Am Sonntag, zwischen vierzehn und fünfzehn Uhr. Ihr wisst ja. In dieser Zeit vergraben sich alle, wirklich alle, irgendwo in geschlossenen Räumen, am besten in Kellern, Tiefgaragen und so weiter. Wer so was mag, kann sich auch im Aquarium die Haie ansehen. Das passt auch. Wichtig ist, dass nirgends Tageslicht hereinkommt. Von der strikten Einhaltung der Bunkerstunde ist unsere Finanzierung abhängig. Also haltet euch daran.“
Während Ingo Kolb seine Anweisungen gab, hatte sich eine Seitentür der Halle noch einmal geöffnet und ein Nachzügler, mit tief über die Stirn gezogener Pudelmütze hatte sich der kleinen Gruppe wortlos angeschlossen. Kolb hatte ihn immer wieder gemustert, irgendwie kam der ihm bekannt vor, aber die Beleuchtung war zu schlecht, um den Neuankömmling wirklich zu erkennen.
Jetzt ging Kolb direkt auf ihn zu, baute sich drohend vor ihm auf und fragte: „Wer bist du, wie kommst du hier herein? Sollten wir dich kennen?
„Aber Ingo“, grinste der so Angesprochene, zog sich die Pudelmütze von der spiegelblanken Glatze und rückte die Nickelbrille mit den kreisrunden Gläsern auf seiner Nase zurecht, „erkennst du mich jetzt wieder?“
„Ich glaub’s nicht! Yogi, altes Haus! Wo kommst du denn her?
„Ist eine lange Geschichte. Bin ja unter die Freien Siedler gegangen. Riesengaudi. Denen kannste echt alles erzählen, und die spuren wie die Hunde. Ich war da echt der King, bis der Schnee kam, und mit dem Schnee dieser Rambo, der mir meinen Platz als Anführer streitig gemacht hat. Als ich ihn verjagen wollte, hat er mich halbtot geschlagen. Ich war lange bewusstlos. Er glaubt, er hätte mich erledigt, aber die beiden Jungs, denen er befohlen hat, mich wie Dreck wegzuschaffen, die haben mich in meine Hütte gebracht und aufgepäppelt. Er war alleine. Als er den ganzen Verein von der Alm nach Garmisch geführt hat, konnte ich schon wieder einigermaßen mithumpeln. Er hat mich nicht mehr bemerkt – aber ich habe ihn beobachtet. Ich habe sogar sein Autokennzeichen. Der wird noch sein blaues Wunder erleben, und ich denke, ihr werdet mir gerne dabei behilflich sein.“
„Aber sicher, immer wieder gerne, Yogi. Und wie bist du dann wieder nach Berlin gekommen?“
„War gar nicht so einfach, und ist auch egal. Kurz vor Weihnachten war ich wieder da. Die alte Clique ausgeflogen, nicht aufzufinden. Glücklicherweise habe ich die Siedlerkasse gerettet. Du glaubst ja gar nicht, was die freiwillig alles abgedrückt haben. Alles für die Gemeinschaftsaufgaben, klar … Ich hab mich erst in einer Pension eingemietet, neue Klamotten hatte ich mir schon in Garmisch gegriffen. Ist ja nicht wahr, dass es da friedlich geblieben ist. Als ich weg bin, gab es kein einziges heiles Schaufenster mehr in dem Kaff – aber es blieb eben auch vollkommen bullenfrei, das war das Schöne. Inzwischen habe ich in Zehlendorf eine Wohnung angemietet und schick eingerichtet. Einen alten Golf konnte ich mir aus Siedlerkasse auch noch leisten. Ja, ich habe mich ein paar Tage ausgeruht, und nun kam der Aufruf zum Treffen und ich dachte, schau mal im Kabelwerk vorbei, vielleicht treffen sie sich ja immer noch dort – und da bin ich nun.“
„Du bist also wieder voll aktiv und am Wochenende dabei?“
Yogi hatte diese Frage erwartet. „Nein, Ingo, geht leider nicht. So fit, wie ich aussehe, bin ich leider noch nicht. Irgendwie ist das psychisch. Depressiv. Fühle mich auch oft desorientiert, kraftlos. Ich würde wohl nur irgendwie dumm im Weg herumstehen. Dabei bin ich ganz und gar auf diesen Typen fixiert, von dem ich erzählt habe, und eure Hilfe, die ich brauche, ist für euch ja ein Klacks. Bitte macht einen Aufruf. Gesucht wird der dunkle SUV, Mitsubishi Pajero, mit dem Kennzeichen E-HM 201. Das hat doch schon oft funktioniert, wenn wir jemanden gesucht haben. Es genügt, mir die Standortmeldungen per SMS durchzugeben. Wenn ich dann alles erledigt habe, schmeiß‘ ich ne Party für euch.“
Ingo gefiel es nicht, dass Yogi sich nicht mehr aktiv beteiligen wollte. Und er hatte einen Verdacht.
„Du warst also auf einer Alm unter den Freien Siedlern. Den ganzen Sommer über. Seit du hier weg bist, gab es für dich keine Bunkerstunde mehr,
oder?“
„Wie denn auch? Erstens gab es da, wo ich war, weder eine Tiefgarage noch einen Zoologischen Garten mit Haifischbecken, und zweitens habe ich ja nie etwas davon erfahren. Das war ja immer so geheim, dass du es nur bei unseren Treffen bekanntgegeben hast. Kann ja aber so schlimm auch nicht sein, denk ich mal.“
„Sorry, Yogi, damit bist du raus. Dein ganzer Psychokram rührt daher, dass du mehrmals zum falschen Zeitpunkt ungeschützt im Freien warst. Es wird nicht mehr lange dauern, und du wirst ebenso zum Schlafschaf geworden sein, wie deine Freien Siedler. Wir hatten schon mehr solche Fälle. Was da passiert, während der Bunkerstunden, das weiß ich nicht. Aber es passiert etwas mit allen Weißen, die sich im Freien aufhalten. Den SUV finden wir für dich noch. Hoffentlich bist du bis dahin noch in der Lage, deine Rache auszuleben. Aber auf deine Party verzichten wir. Komm nie wieder hierher – und jetzt verschwinde.“
Yogi schlich davon wie ein begossener Pudel. Er hatte erreicht was er erreichen wollte – und jetzt war er einfach nur noch müde und wollte seine Ruhe. Irgendwie war er froh, dass Ingo ihn davongejagt hatte. Wenigstens brauchte er jetzt keine Ausreden mehr erfinden, warum er sich nicht mehr beteiligen wollte.
Feldkirchen
Donnerstag, 9. Februar 2023
Die SMS ließ Yogis Herz höherschlagen.
E-HM 201 auf A94 hinter München gesichtet. Verließ A94 bei Ausfahrt Feldkirchen West. Steht in der Schwalbenstraße. Viel Glück!
Keine vierundzwanzig Stunden nachdem er seine Bitte geäußert hatte, war der SUV geortet. Jetzt galt es schnell zu sein. Ein Wagen mit Essener Kennzeichen würde nicht ewig in Feldkirchen stehenbleiben. Yogi war auf diesen Augenblick vorbereitet. Was er für seine Rache brauchte, war längst im Kofferraum seines Wagens verstaut. Die Flasche mit dem flüssigen Grillanzünder ebenso wie das Brecheisen – und im Handschuhfach die Pistole.
Er brühte sich noch einen Kaffee, und danach brach er auf. Er würde in der Nacht kaum mehr als sechs Stunden brauchen und könnte ganz früh am Morgen die Lage peilen. Er würde sich einen geschützten Platz für das eigene Auto suchen und den SUV im Auge behalten, bis zum Einbruch der Dunkelheit. Schließlich sollte das Feuer schnell entdeckt werden. Der Fahrer würde aus dem Haus kommen – und Yogi zweifelte nicht im Geringsten daran, ihn sofort wiederzuerkennen – und dann hätte er ihn in bester Schussposition vor sich.
Als er merkte, dass er müde wurde, hielt er an einer Autobahnraststätte, fuhr erst zum Tanken, ging dann zur Toilette, trank einen großen Kaffee zum Schinken-Käse-Baguette, und kaufte zum Schluss noch ein paar Snacks und Getränkedosen, damit er nicht gezwungen sein würde, wegen Hunger und Durst seine Beobachtungsposition in Feldkirchen aufzugeben.
Kurz nach halb fünf Uhr morgens sagte die angenehme Frauenstimme des Navis: „Sie haben das Ziel erreicht.“
Das war also die Schwalbenstraße. Es war noch sehr dunkel. Langsam fuhr er die Straße mit ausgeschalteten Scheinwerfern ab. Lauter hübsche Einfamilienhäuser. Die Autos standen wohl alle in den Garagen oder in den Einfahrten. Den dunklen SUV sah er erst, als er schon fast aufgefahren war.
„Der weiß schon, warum er kein rotes Auto fährt“, dachte Yogi, umkurvte den Pajero, wendete am Ende der Straße und hielt an. Es gab keinen Platz, der von seinem Ziel aus nicht eingesehen werden konnte. Also beschloss er, so weit weg als möglich, da wo die Schwalbenstraße als Sackgasse endete, Stellung zu beziehen.
Die Stunden zogen sich schier endlos hin. Zwischen sieben und acht waren einige Anwohner mit ihren Pkws losgefahren, wahrscheinlich zur Arbeit. Danach hin und wieder ein Kleinwagen, mit dem wahrscheinlich eine Hausfrau zum Einkaufen fuhr oder auch wieder zurückkam. Am Nachmittag war überhaupt niemand zu sehen. Auch der SUV blieb unbewegt den ganzen Tag an seinem Platz. Vom Fahrer keine Spur. Am späten Nachmittag kehrten die Berufstätigen zurück. Seit achtzehn Uhr herrschte Friedhofsruhe, in der Schwalbenstraße. In den Häusern gingen Lichter an, manche auch wieder aus, und dann war es so finster, wie es in einer abgelegenen Straße am Waldrand nur sein kann. Es gab zwar ungefähr alle dreißig Meter eine Straßenlampe, doch was nicht in deren unmittelbarem Lichtkegel lag, blieb finster genug, um sich unbemerkt anschleichen zu können.
Yogi wusste, dass jetzt der Zeitpunkt zum Handeln gekommen war, doch er konnte sich einfach nicht aufraffen. Endlich gab er sich einen Ruck, stieg aus, holte Brecheisen und Grillanzünder aus dem Kofferraum, schloss diesen so leise wie möglich wieder und näherte sich, den Laternen ausweichend, vorsichtig dem Pajero. Wieder zögerte er. Stand unentschlossen herum, nahm das Brecheisen von der einen in die andere Hand, schwang es probeweise auf die rechte vordere Seitenscheibe zu, um dann im letzten Moment wieder abzubrechen. Er musste sich zwingen, die Situation in Grainau noch einmal vor seinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen, noch einmal den Faustschlag ins Gesicht zu spüren und die Demütigung, schon wieder zu Boden geschickt worden zu sein, die er als Letztes empfand, bevor bei ihm die Lichter ausgingen. Er sah noch einmal die kühlen grauen Augen seines Gegners, die ihn spöttisch anlächelten – und dann schlug er mit der Brechstange zu. Glas splitterte mit lautem Klirren. Für einen Augenblick kehrte wieder Stille ein. Yogi fummelte am Kinderverschluss der Anzünder-Flasche, und dann brüllte die Alarmanlage des Pajero auf. Lautes, dröhnendes Hupen, in verdammt kurzen Abständen. Bald würde die ganze Straße hier zusammenlaufen. Endlich hatte er die Flasche offen, hielt sie durch die zerbrochene Scheibe und begann den Inhalt durch Druck auf die Flasche auszuspritzen. „Warum, verdammt, dauert das so lange?“, fragte er sich inzwischen völlig nervös und unruhig. Weil es ihm zu lange dauerte, warf er dann die ganze Flasche in den Innenraum. „Wird schon anbrennen“, dachte er sich, und fischte nach dem Feuerzeug in seiner Hosentasche. Dann stellt er fest, dass er sich mit dem Kopf durch das zerbrochene Fenster in den Wagen beugen musste, um die mit der Anzünder-Flüssigkeit benetzte Sitzfläche des Fahrersitzes – auf der Beifahrerseite war gar nichts von der Flüssigkeit angekommen – mit dem Feuerzeug erreichen und in Brand stecken zu können.
Er hatte es fast geschafft. Da spürte er, wie er von hinten kraftvoll gegen die Beifahrertür gedrückt wurde und weder vor noch zurückkonnte. Die Warnung, dass er nur mit einem ziemlich verkohlten Kopf aus dem Auto herauskäme, wenn er den Wagen jetzt anzünden würde, hätte es gar nicht gebraucht. Yogi brach psychisch und physisch zusammen, er hing kraftlos in der Zwangsposition, von der er sich nicht zu lösen vermochte, und dabei nässte er sich mit einer seit vielen Stunden nicht geleerten Blase gründlich ein.
Als Harald den Autoknacker dann aus dem Wagen zog, war er ziemlich überrascht. Mit Yogi hatte er nie und nimmer gerechnet. „Du hast also überlebt, du Häufchen Scheiße!“ brüllte er ihn an und kümmerte sich nicht darum, dass inzwischen überall Leute ihre Köpfe aus den Fenstern streckten und ein paar Mutige sogar auf der Straße auf ihn zukamen.
„Was ist passiert?“ – „Brauchen Sie Hilfe?!“
„Da wollte wohl jemand mein Autoradio klauen. Mehr ist nicht. Entschuldigen Sie die Ruhestörung. Aber manchmal geht so eine Alarmanlage eben tatsächlich dann los, wenn sie soll.“
Mit einem Druck auf den Funkschlüssel brachte er endlich auch den Alarm zum Verstummen. Ein paar Neugierige drückten sich noch herum und bestaunten die kaputte Scheibe. Harald kümmerte sich nicht darum. Er zog und schob seinen Gefangenen, denn genau als das betrachtete er Yogi, durch den Vorgarten Richtung Haustür.
„Werft mir mal einen Schal oder so was heraus, aber lasst euch nicht blicken, sprecht auch nicht. Ich muss hier erst jemandem die Augen verbinden.“
Kurz darauf bugsierte er Yogi mit verbundenen Augen ins Haus. Im Flur herrschte er ihn an: „Zieh die Hosen aus. Die Unterhosen auch. Du saust sonst hier ja alles voll!“
Yogi gehorchte mit zitternden Händen. Harald fasste die Klamotten mit spitzen Fingern an und warf sie hinaus in den Garten. Dann führte er den unerwarteten Besuch zu den anderen und verkündete:
„Darf ich vorstellen: Großmeister Yogi von den Freien Siedlern zu Grainau höchst persönlich.“
Yogi, oben mit Hemd, Pullover und Parka bekleidet, aber von der Hüfte an abwärts nackt, versuchte vergeblich seine Blöße zu verdecken. An Fritz gewandt fragte Harald: „Hast du hier irgendwie einen alten Gartenstuhl und eine Wäscheleine? An deinen Polstermöbeln soll der Kerl sich nämlich nicht den Hinter wetzen.“
Fritz schleppte einen frühmittelalterlich wirkenden Klappstuhl heran und stellte ihn in der Mitte des Raumes auf. Harald schob Yogi grob dahin und drückte ihn auf das harte Sitzmöbel. Dann band er Yogi so geschickt am Stuhl fest, dass er unweigerlich auf die Nase fallen musste, wollte er auch nur einen Versuch machen, aufzustehen.
„Ja, Freunde, das wird jetzt hoffentlich eine vergnügliche Unterhaltung“, verkündete Harald und versetzte Yogi mit der flachen Hand einen leichten Schlag ins Gesicht.
„Ich denke, wir werden viel Interessantes erfahren.“
Fritz und Bernd, die seit drei Tagen dabei waren, mit Harald gemeinsam die Marschroute für die erste Verhandlungsrunde zur Begründung der Kooperation mit MAD und Bundeswehrangehörigen festzulegen, hatten zwar die Geschichte mit Yogi von Harald gehört, konnten sich auf dessen plötzliches Auftauchen in Feldkirchen und seinen total derangierten Zustand aber keinen Reim machen. Auch Haralds Verhalten erschien ihnen irgendwie befremdlich, und was Harald Interessantes erwartete, konnten sie sich auch nicht vorstellen. Aber sie blieben still und warteten ab.
„Sag uns erst mal deinen Namen, lieber Freund“, begann Harald sein Verhör.
„Yogi“
„Du sollst mich nicht verarschen“, sagte Harald mit warnendem Unterton und versetzt ihm erneut eine Ohrfeige, die Yogis Kopf, der nach wie vor nichts sehen und daher auch nicht reagieren konnte, heftig zur Seite schleuderte.
„Also, wie heißt du?“
„Joachim Schröder, geboren am 18. Juni 1991 in Berlin“, brachte er mühsam und stockend heraus, dabei erkennbar bemüht, sich keine weitere Ohrfeige einzufangen. Harald schlug dennoch noch einmal zu und sagte dabei in ganz freundlichem Ton: „Siehst du, es geht doch. Warum nicht gleich so?“, und noch einmal klatschte seine Handfläche in Yogis Gesicht.
Dann schwieg er. Eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten. Für Yogi dehnten sich die Sekunden zu Ewigkeiten. Seine Gedanken spielten in seinem Kopf Karussell, doch er vermochten keinen festzuhalten. Als er es nicht mehr aushielt, begann er von sich aus zu sprechen. Trotzig, und aufs Schlimmste gefasst, denn er glaubte, diesen Raum nie mehr lebend verlassen zu können.
„Ich hätte dich umgebracht. Erschossen, wie einen räudigen Hund, wäre die blöde Alarmanlage nicht losgegangen“, stieß er keuchend hervor.
„Aha“, meinte Harald, „das wird ja immer schöner. Womit wolltest du mich denn erschießen. Ich habe keine Waffe bei dir gefunden.“
„Die … die hab ich im Handschuhfach vergessen.“
„In welcher Tasche steckt dein Autoschlüssel, wo steht dein Wagen?“
„Jackentasche rechts. Der weiße Golf steht ganz hinten in der Straße.“
Harald fischte den Autoschlüssel aus Yogis Tasche, reichte ihn an Bernd Brenner weiter, der wortlos das Haus verlies und nach fünf Minuten mit einer geladenen Pistole in der Hand zurückkam, die er Harald in die Hand gab.
Harald drückte den Lauf der Waffe in Yogis Genick. „Damit also wolltest du mich erschießen. Daraus wird nun leider nichts mehr.“ Dabei drückte er den Lauf der Waffe noch ein bisschen fester in Yogis Genick bis der einen unterdrückten Schmerzenslaut von sich gab.
„Es wird sich bald noch eine Verwendung für diese Waffe finden, Herr Schröder“, blafft er den inzwischen deutlich nach Angstschweiß riechenden Yogi an. „Aber erst wollen wir unsere Unterhaltung zu Ende bringen. Je mehr Sie mir erzählen, werter Herr Schröder, desto länger werden Sie noch leben. Also, nächste Frage: Wie haben Sie mich gefunden?“
Yogi entschied sich dafür, noch möglichst lange zu leben. Vielleicht käme ja doch noch irgendwo ein rettendes Lichtlein her. Also erzählte er ausführlich von seinen Berliner Freunden, die er gebeten hatte, den Wagen Haralds, den er selbst in Garmisch noch gesehen hatte, aufzuspüren. Er berichtete stolz, wie schnell die Antifafahndung erfolgreich war, wie er über Nacht nach Feldkirchen gefahren war, den ganzen Tag im Auto verbracht hatte, bis zum Einbruch der Dunkelheit, und endete mit den Worten: „Ja, und dann haben Sie mich ins Auto gedrückt.“
Aber Harald hatte damit viele Anknüpfungspunkte für neue Fragen. Den Treffpunkt in Berlin wollte er erfahren. Wie stark die Truppe war, wie ihr Anführer hieß, und ob es noch weitere Gruppen in Berlin gab.
Yogi antwortete freimütig. Die wollten ihn sowieso nicht mehr dabeihaben, also konnte er plaudern. Er erzählte von der alten Werkshalle in Siemensstadt, von den Wachmännern, die alles andere im Sinn hatten, als Wache zu schieben, er erzählte, dass sie im letzten Jahr, bevor er zu den Freien Siedlern gegangen war, ungefähr zweihundert waren, etwa ein Drittel davon Frauen, dass der Anführer Ingo hieß, und nach einer weiteren aufmunternden Ohrfeige auch dessen Nachnamen, Kolb. Weitere Gruppen gäbe es, doch gäbe es unter den Gruppen keine Kontakte, sogar bei Aktionen trafen nie Mitglieder unterschiedlicher Gruppen zusammen. Die Lauf- und Rückzugswege würden – von oben – vorgegeben, und wer sich nicht daran hielt, musste mit Strafen rechnen.
Dann fragte Harald: „Was wurde bei dem Treffen besprochen, an dem du vor ein paar Tagen teilgenommen hast?“
„Ingo hat eigentlich nur zwei Sachen herausgestellt. Es soll eine Verschönerungsaktion stattfinden. Er hat ungefähr fünfzehn Gruppen gebildet und denen je drei Adressen zugeteilt, wo in der Nacht von Samstag auf Sonntag so spezielle Graffitis an die Häuser von Nazis und Bullen gesprüht werden sollen.“
„Und, bist du da auch eingeteilt? Kennst du die Adressen?“
„Sorry. Nein. Ich bin da raus. Ich war zu lange fort und habe bei den letzten Bunkerstunden nicht mitgemacht. Wer da nicht mitmacht, fliegt raus, außerdem werden die Gelder gekürzt, für die ganze Gruppe.“
„Was heißt Bunkerstunde?“
„Bunkerstunde – wie soll ich das erklären? Die nächste ist am Sonntag zwischen fünfzehn und sechzehn Uhr. In dieser Zeit müssen wir uns an einem Ort aufhalten, an dem es kein Tageslicht gibt. Keller, Tiefgarage, oder eben das Haiaquarium im Zoologischen Garten. Sowas.“
„Und was soll damit erreicht werden?“
„Weiß ich nicht. Weiß Ingo wahrscheinlich auch nicht. Ist Befehl von ganz oben. Mir hat er gesagt, dass ich bei den Freien Siedlern zu viele Bunkerstunden im Freien verbracht habe und daher praktisch untauglich geworden sei. Was ich bei mir für ein Psycho-Problem halte, also dieses Depressive, die Antrieblosigkeit, wahrscheinlich auch, dass ich tatsächlich vergessen habe, die Pistole aus dem Handschuhfach zu nehmen, dazu hat er gesagt, das habe ich mir fast wörtlich gemerkt, weil ich so etwas noch nie gehört habe: ‚Dein ganzer Psychokram kommt davon, dass du zu oft zum falschen Zeitpunkt ungeschützt im Freien warst. Es wird nicht mehr lange dauern, und du wirst ebenso zum Schlafschaf geworden sein, wie deine Freien Siedler.‘ Außerdem hat er noch gesagt, es hätte schon mehr solcher Fälle gegeben.“
Fritz, der bis dahin keinen Ton von sich gegeben hatte, pfiff leise durch die Zähne und signalisierte heftiges Mitteilungsbedürfnis. Harald winkte Bernd stumm zu sich heran. Einer links, einer rechts packten sie Gartenstuhl samt den Häufchen Elend, das darauf festgebunden war. Fritz erkannte die Absicht, sprang zur Tür und hielt sie weit auf. Gleich darauf stand der Stuhl hinten im Flur am Treppenaufgang. Yogi würde von dem, was jetzt zu besprechen war, nichts mitbekommen.
„Den Jungen hat uns der Himmel geschickt,“ begann Fritz mit vor Begeisterung gerötetem Kopf.
„Die Bunkerstunden. Die Bunkerstunden sind die Lösung. Das sind fast alles Weiße, die Antifanten. Wir hielten sie für immun. Sie sind nicht immun, nicht immun, wie ihre schwarzen Freunde, die sie zu tausenden aufhetzen. Die werden vor der Strahlung geschützt, indem man sie für eine Stunde in die Keller verbannt. Das ist es. Und wir wissen nun sogar noch, wann die nächste Bunkerstunde geplant ist wir wissen also auch, auf die Stunde genau, wann der nächste Impuls kommen wird. Das ist die Chance, endlich die Satelliten zu orten, deren Spuren bisher immer nur nachträglich im Datenwust der Radioteleskope zu finden waren. Ich muss nach Effelsberg. Ich fahre gleich morgen früh.“
Im Flur gab es mächtigen Krach und danach ein schmerzvolles Stöhnen.
„Jetzt hat er versucht, aufzustehen. Ich hätte ihn warnen sollen,“ grinste Harald schadenfroh.
„Was machen wir jetzt mit dem?“, wollte Bernd wissen. „Ich denke, wir setzen ihn, wie er ist, in sein Auto. Kannst du das schon mal holen, Bernd? Wir geben ihm den Schlüssel, werfen ihm die verpisste Hose nach und sagen ihm, er hätte genau drei Minuten Zeit für immer hier zu verschwinden. Der nützt uns jetzt nichts mehr, und wenn er uns irgendwo verpfeifen sollte, wird er dort vermutlich mehr als nur die paar Ohrfeigen einfangen, die halt leider erforderlich sind, um so ein Verhör bei einem solchen Typen erfolgreich zu gestalten. Am besten wäre es für ihn wohl, wenn er sich schleunigst ganz weit weg davonmacht. Italien, Sizilien, wer weiß, vielleicht Marokko, wo er sicher sein kann, dass ihn niemand kennt.“
Als das Auto vor der Tür stand, entließ Harald seinen immer noch nur dürftig bekleideten Gefangenen in die Freiheit, nahm ihm die Augenbinde ab, drückte ihm den Fahrzeugschlüssel in die Hand und befahl: „Abmarsch, aber dalli!“
Zweimal würgte Yogi den Motor ab. Dann war er weg.