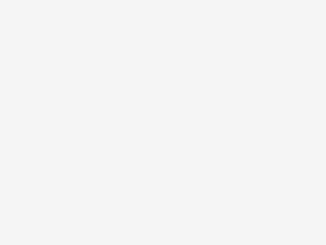PaD 14 /2022 – Hier auch als PDF-verfügbar: Pad 14 2022 Über die Verblödung (1)
Ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, ist der zunehmende Verlust von Wissen, Können und Vernunft, einhergehend mit dem Verlust des Unterscheidungsvermögens zwischen Sinn und Unsinn, der Unfähigkeit, selbst eklatante Widersprüche zu erkennen und diese logisch aufzulösen, bis Lüge und Wahrheit als solche zu erkennen sind. Ich nenne diese Entwicklung „Verblödung“, doch mir ist diese Einordnung nicht genug. Ich versuche die Ursachen zu ergründen und dabei jene möglichen Maßnahmen zu erkennen, die notwendig wären, um die Tendenz wieder umzukehren. Die Fülle der Symptome und ihrer negativen Wirkungen ist zu groß, um alles in einem einzigen Aufsatz zu beleuchten. Daher wird es eine Serie von Paukenschlägen geben, die jeweils schwerpunktmäßig einen der zu behandelnden Themenkreise aufgreifen. Der heute vorgelegte Teil 1 beschäftigt sich mit den prägenden Einflussfaktoren der kindlichen Entwicklung.
Über die Verblödung
Es ist längst mehr als eine Hypothese, sondern empirisch gesichertes Faktum, dass das deutsche Volk zunehmend verblödet. Dies darf allerdings nicht dahingehend missverstanden werden, dass das ganze deutsche Volk nur noch aus hilflosen Idioten bestünde. Eine erhebliche Spreizung von Wissen, Denkvermögen und Kreativität ist durchaus noch festzustellen. Das Problem besteht darin, dass sich das Niveau auf allen Ebenen zum Negativen hin verändert hat.
Spurensuche an der Basis
Der Hauptschulabschluss befähigt nicht mehr grundsätzlich zur Aufnahme einer Berufsausbildung, das Zeugnis der Reife befähigt nicht mehr grundsätzlich zur Aufnahme eines Studiums, ein akademischer Grad befähigt nicht mehr grundsätzlich zur Übernahme verantwortlicher Aufgaben in Unternehmen oder Behörden und garantiert keineswegs mehr, damit zu einem auskömmlichen Einkommen gelangen zu können. Die Universitäten produzieren mehr Studienabbrecher als Absolventen innerhalb der Regelstudienzeit. Die Ergebnisse der Schulvergleichstests (PISA) lassen dieses Manko schon seit geraumer Zeit deutlich erkennen.
Versucht man, die für diese Entwicklung verantwortlichen Einflüsse zu identifizieren und beginnt damit, eine über lange Zeiträume gültige Konstante zu suchen, dann trifft man auf die genetisch bedingte, natürliche Neugier von Kindern, verbunden mit den Versuchen, sich selbst „auszuprobieren“ und über den Weg der Entdeckung der Umwelt und der möglichen Interaktionen mit dieser Umwelt zu lernen, was sowohl „Wissen sammeln“ als auch „Erfahrungen machen“ einschließt.
Das wird sichtbar, sobald ein (gesundes) Baby in der Lage ist, sich krabbelnd selbstständig fortzubewegen und sich an Stühlen oder niedrigen Tischen aufzurichten. Nichts ist mehr vor dem schnellen Zugriff sicher, doch das Kind, das anfänglich noch Dinge seines Interesses ungeschickt nur umgeworfen hat, lernt ziemlich schnell, sie zu greifen, festzuhalten – und dann auch wieder absichtlich wegzuwerfen, wobei sich dabei auch eine gewisse Zielsicherheit entwickelt.
Was Eltern oder Geschwister tun, wird beobachtet und nachzuahmen versucht, oft mit staunenswerter Geduld und Beharrlichkeit. Es ist, schon bevor das Kind zu sprechen beginnt, ein starkes „Können-Wollen“ festzustellen.
Dieser – ich nenne es einmal „Lerntrieb“ – ist vorhanden, was auch die Wissenschaft, wie unter anderem der Neurobiologe Gerald Hüther, bestätigt.
Nun gibt es Menschen, die sich diese Neugier und die Beharrlichkeit im Erkunden bis ins hohe Alter bewahren, während andere oft schon von Beginn der Adoleszenz an dazu übergehen, nur noch vom Schatz des bis dahin Erlernten zu zehren, indem sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu Gewohnheiten gerinnen lassen, die immer nur – ohne geistige Anstrengung – neu reproduziert zu werden brauchen.
Sicherlich ist die Ausbildung von Gewohnheiten ein erheblicher Vorteil, um mit den Routineaufgaben und Problemstellungen im Alltag und im Beruf mit geringst möglichem Energieaufwand zurecht zu kommen. Wo aber alleine die Routine übrig bleibt, ist der Mensch im Grunde bereits tot, bzw. hat sich in eine Art Roboterwesen verwandelt, dessen „Intelligenz“ bis auf eine Reihe von eingeübten „Reiz-Reaktions-Mustern“ vollkommen ruhig gestellt ist.
Wenn also festzustellen ist, dass die Lernergebnisse vom Grundschüler bis zum Gymnasiasten nachlassen, während der genetisch verankerte „Lerntrieb“ unverändert geblieben sein dürfte, muss die Ursache der schlechteren Ergebnisse in einem anderen Zusammenhang gesucht werden. Es wird oft erklärt, die Schule als solche versage, weil sie den Schülern immer noch zu wenig Möglichkeiten gibt sich im Unterricht einzubringen, vor allem ihren jeweiligen eigenen Lerninteressen zu folgen und dabei unterstützt zu werden.
Diese Erklärung wird natürlich gerne von reformwilligen Pädagogen vorgetragen, wobei die Verweise auf Montessori- und Waldorfschulen, die nach solchen Konzepten vorgehen, nicht ausbleiben. Diese Erklärung ist jedoch unzulässig, weil der aktuelle, also stichtagsbezogene Vergleich, zwischen den Leistungen der öffentlichen Schulen und solcher Privatschulen, natürlich Unterschiede zum Vorschein bringt, die jedoch nichts darüber sagen, wie sich die Schulerfolge in den Systemen über die Zeit verändert haben.
Im Wesentlichen sind Didaktik und Methodik an den öffentlichen Schulen über Jahrzehnte gleich geblieben. Es dominieren der Frontalunterricht und das Ermitteln des Lernerfolgs durch die Lehrkraft in mündlichen und schriftlichen Abfragen, was abschließend in einem Notensystem zwischen sehr gut und mangelhaft, bzw. unbefriedigend zum Ausdruck gebracht wird.
Die Schüler haben wenig Mitspracherechte bei der Unterrichtsgestaltung, der Lehrplan diktiert das Fortschreiten im Stoff für alle Schüler einer Klasse gleichermaßen, Defizite bei einzelnen Schülern können nur durch Nachhilfe, in der Regel außerhalb des Einflussbereichs der Schule, gezielt bearbeitet werden.
Wenn also das, was noch vor 50, 60 Jahren so gut funktionierte, dass die Leistungen der damaligen Schüler, trotz deutlich größerer Klassen, höher zu bewerten sind als die Leistungen der heutigen Schülerjahrgänge, dann kann, trotz gewisser Veränderungen im Schulalltag und der zu vermittelnden Lerninhalte, auch der „Schulbetrieb“ nicht als die gesuchte Variable angesehen werden, sondern muss als zuverlässige Konstante eingestuft werden, die in erster Näherung als Ursache nicht infrage kommt.
Anders sieht es beim außerschulischen Umfeld der Kinder und Jugendlichen aus. Das beginnt in der Familie, die in den Fünfziger-Jahren mehrheitlich aus einem Elternpaar bestand, zwischen dem eine klare Trennung zwischen Erwerbsarbeit (in der Regel der Mann) und Familienarbeit (in der Regel die Frau) bestand, wobei nach der Eheschließung, die in der Regel im Altersbereich von 20 bis 25, seltener bis 30 Jahren erfolgte, relativ schnell zwei bis drei Kinder in kurzem zeitlichen Abstand zur Welt kamen. Einzelkinder und Familien mit mehr als drei Kindern waren hingegen selten, noch seltener die alleinerziehende Mutter.
Das soll nun kein nostalgisch romantisierendes Familienbild heraufbe-schwören, sondern lediglich den Vergleich ermöglichen, zwischen jenen Möglichkeiten die Kinder damals hatten, ihre Neugier zu befriedigen und sich selbst auszuprobieren, und jenen Kindern, die heute in der klassischen Ein-Kind-Familie mit spät gebärender und spätestens ab dem dritten Lebensjahr wieder berufstätigen, häufig alleinerziehenden und besorgt über ihr Kind wachenden Mutter, aufwachsen.
Damals waren die Kinder in den Altergruppen zwischen vier und vierzehn Jahren einen großen Teil des Tages „draußen“. Sprichwörtlich auf der Straße, in den Höfen und Hinterhöfen der Nachbarhäuser, in eher ländlichen Gegenden auch in den umliegenden Wäldern. Oft zusammengeschlossen zu Gruppen, die sich stolz „Banden“ nannten und sich gegenseitig, spielerisch bekämpften. Achtjährige schleppten im Auftrag der Mutter die Vier- und Fünfjährigen mit und waren gehalten, auf diese aufzupassen. Trotz aller Wildheit waren die Kinder geübt darin, ihre Kleidung möglichst nicht zu beschmutzen und schon gar nicht zu beschädigen, denn davon gab es nicht so viel, oftmals mussten die Jüngeren die Sachen der älteren Geschwister auftragen, und die Waschmaschine war auch längst nicht in jedem Haushalt vorhanden.
Es gab also massenhaft „Umgebung“ zu entdecken. Die Jungs lernten dabei Automobilmarken und Modelle zu unterscheiden, und drückten sich die Nasen an den Scheiben geparkter Autos platt, um einen Blick auf den Tacho zu erhaschen und festzustellen, wie schnell das Auto fahren könne. Tags drauf, an der sprudelnden Quelle am Berghang wurden aus Ästen und Steinen, aus Blättern und Erde Staudämme errichtet, oft mehrere hintereinander, und es war ein Riesenvergnügen, dann den höchsten Damm anzustechen oder zu zerstören, und zu beobachten, wie die tiefer liegenden Dämme dem Wasser standhalten würden. Dann übte man sich gemeinsam im Klettern an geeigneten und ungeeigneten Bäumen.
Die Mädchen blieben unter sich. Bewunderten gegenseitig ihre Puppen, vor allem wenn eine ein neues Kleid erhalten hatte, holten dann ein Springseil oder malten sich Quadrate auf den Bürgersteig, in denen sie nach bestimmten Regel, mal mit dem linken, mal mit dem rechten, mal mit beiden Beinen aufkommend herumhüpften. Dann wieder erfanden sie lustige Geheimsprachen, in denen sie sich tagelang mit wachsender Begeisterung unterhalten konnten, immer in der Annahme, niemand sonst könne sie verstehen.
Das alles spielte sich, solange das Wetter es zuließ – und das Wetter hat damals viel zugelassen – im Freien ab. Möglichst außerhalb der Sicht- oder Rufweite der Mutter, aber mit der Gewissheit, jederzeit mit jedem physischen oder psychischem Wehwehchen, mit jeder Frage, jedem Problem in wenigen Minuten zur Mutter kommen zu können, die garantiert helfen würde.
Heute wird das behütete Kind nach dem Frühstück aus Cerealien und Obsthäppchen mit dem Auto zur Schule oder zur KiTa verfrachtet, wo die verfügbaren Betreuer oder Lehrkräfte nicht ausreichen, um den Bedürfnissen der Kinder in der notwendigen Intensität und auch „Nähe“ noch genügen zu können. Die Abholung mit dem Auto beendet den ersten Ausflug des Tages.
Die Mikrowelle spuckt ein Fertiggericht aus. Draußen spielen? Ja. Aber die Mutter ist dabei und steuert den Spielplatz mit seinen in monotoner Einfalt bundesweit einheitlichen Gerätschaften (Schaukel, Rutsche, Klettergerüst, etc.) an, wo sich das Kind beschäftigen soll, aber bloß nicht zu toll. Kommt es zum Streit zwischen Kindern stehen die Mütter schon dazwischen, bevor der erst Knuff oder Schubs gelandet werden konnte.
Wenn „Klavier“ auf dem Stundenplan steht, oder „Reiten“ oder „Ballett“ ist auch der Nachmittag mit schulähnlichen Aktivitäten verbraten. Hausaufgaben stehen auch noch an, und, ja, auch der Fernseher oder der PC verlocken dazu, Dinge nachzuentdecken, die andere vorentdeckt und mundgerecht aufbereitet haben.
Im Prinzip ist der Unterschied ungefähr so groß, wie der zwischen einem auf gut Glück angetretene Frankreich-Urlaub mit dem Camper und der Rundum-Betreuung des Urlaubers im Club-Hotel, dessen Gelände nur verlassen wird, um an dem zugebuchten Bus-Ausflug zu einer vorbestimmten Sehenswürdigkeit teilzunehmen, weil man, wenn man schon mal da ist, ja wenigstens auch …
Ich spreche hier gar nicht von jenen bedauernswerten Geschöpfen, die tagtäglich stundenlang mit einer Flasche Cola und Süßigkeiten vor dem laufenden Fernseher geparkt werden. Das ist ein Problem für sich.
Ich spreche vor allem von jenen Kindern, Einzelkindern, deren Eltern stolz darauf sind „viel mit dem Kind zu unternehmen“, ohne dabei zu bemerken, dass sie dem Kind damit die Möglichkeit nehmen, selbst, auf eigenes Risiko, etwas zu unternehmen. Diese Kinder sind verplant, eingespannt und haben die Überzeugung ihrer Eltern, dass es ihnen so gut ginge, so tief verinnerlicht, dass ihre Erwartung an das Leben mehr und mehr darin besteht, durchgehend versorgt und bespaßt zu werden. Was ich oft von Kindern gehört habe, ist der Satz: „Mir ist langweilig.“ Auf die Frage dann: „Was möchtest du denn unternehmen?“, kommt in 98 Prozent der Fälle die Antwort: „Keine Ahnung, weiß nicht.“
Für solche Kinder könnte, ich stelle mir das so vor, der Schulbesuch von der gleichen Qualität sein, wie der Besuch im Zoo, nur dass es da kein Eis und keine Limo gibt, die man nebenbei vernaschen könnte. Wenn man bei den Affen steht, amüsiert man sich ein Weilchen, aber auf dem Weg von den Affen zu den Seelöwen und Pinguinen ist alles, was zu sehen wäre, einfach nur stinklangweilig.
Es ist die „Action“ anderer, die man als Zuschauer genießt. Im Zoo, wie in der Schule. Daran kann man sich sogar für eine Weile erinnern. Der Rest ist uninteressant, langweilig und wird als Zumutung abgelehnt.
Diese Haltung, mit der eben viele Kinder in die Schule kommen, weil sie in diese hinein erzogen wurden, weil sie sich nie selbst eine Aufgabe oder einer Herausforderung stellen und diese bis zum Ende, und sei es bis zum bitteren Ende, durchziehen konnten, haben sie eine passive Rolle eingenommen, teils als nur Zuschauer, teils als Ausführende der von den Eltern zugewiesenen Beschäftigungen.
Sich aus dieser Haltung heraus mit dem Schulstoff beschäftigen zu müssen, und dies wieder nur, weil die Eltern gute Noten erwarten, ist keine Motivation, sondern eher ein Zwang, dem man gern entrinnen möchte.
Inzwischen ist dieses Phänomen so weit entwickelt, dass Schulen und Kultusministerien die Anforderungen auf breiter Front gesenkt haben, so dass die guten Noten, die sich die Eltern wünschen, auf dem Papier immer noch vergeben werden können, während die tatsächlichen Leistungen nicht sehr gut, sondern vielleicht befriedigend, nicht gut, sondern vielleicht ausreichend und nicht immer noch befriedigend, sondern längst unzureichend sind.
Der Schwindel fliegt auf, wenn der Bewerber für die Ausbildungsstelle beim Installateur nicht in der Lage ist, zweistellige Zahlen im Kopf zu addieren, oder im Brustton der Überzeugung erklärt, dass natürlich dass Kilo Blei schwerer ist als ein Kilo Federn – blöde Frage!
Zum Abschluss der Spurensuche an der Basis will ich noch anmerken, dass ein anderer Erklärungsversuch, nämlich die Projekte mit der Inklusion Behinderter und Lernschwacher, sowie der zunehmende Anteil von Kindern ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, zwar eine gewisse Berechtigung da hat, wo die Schule die Lehrkraft mit dieser Situation einfach alleine lässt, nach dem Motto: „Sieh‘ zu, wie du damit fertig wirst!“, dass aber der Leistungsabfall insgesamt damit nicht erklärt werden kann.
Schüler mit der Motivation zu lernen, sind durch Mitschüler, die im Stoff zurückbleiben, nicht zu bremsen. Es hat immer die drei oder vier Klassenbesten gegeben, und am anderen Ende der Skala jene drei oder vier Kandidaten für die Wiederholung des Schuljahres, dazwischen alle diejenigen, mit durchschnittlich guten bis befriedigenden Leistungen.
Das Problem ist nicht die Behinderung. Da zeigen positive Erfahrungen, dass sich diejenigen Schüler, die sich leichter tun, mit dem Lernen, sich auch gerne einschalten, um das Kind mit Behinderung mitzuziehen.
Das Problem ist auch nicht der Migrationshintergrund. Wenn vorbereitend die Sprachschulung gelingt, so dass die Teilnahme am Unterricht möglich ist, bleibt auch hier nur wieder die Motivation übrig. Diese Motivation entspringt allerdings nur einem sicheren Selbstbewusstsein, das weiß, dass es Schwierigkeiten überwinden kann und sich nicht scheut, für den Erfolg auch einmal eine besondere Anstrengung auf sich zu nehmen.
Es ist dabei in diesem Stadium noch nicht die ausgeprägte Faulheit, das Erstarren in Routinen, wovon viele junge Erwachsene befallen sind. Es sind Unsicherheit und aus der Unsicherheit resultierende Ängste, die dazu führen, dass Schüler sich der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Stoff, und vor allem dem Versuch, Zusammenhänge zu verstehen, verweigern.
Dass Klein-Lucca und Klein-Lina dennoch überzeugt sind, die wertvollsten Mitglieder der menschlichen Gesellschaft zu sein, liegt nicht zuletzt daran, dass „moderne Erziehungsratgeber“ dazu anhalten, das eigene Kind in einem Lügengewebe gefangen halten, das ungefähr so klingt: „Das hast du fein gemacht, das hast du gut gemacht. Niemand malt so schöne blaue bananenförmige Äpfel wie du.“
Wo alles gelobt wird, um ja das Seelchen nicht zu erschüttern, entwickeln sich seelische Krüppel, die beim ersten Kontakt mit der ungefilterten Realität zu zerbrechen drohen.
Dass Bücher und Filme in Universitätsbibliotheken mittlerweile mit Warnhinweisen (Triggerwarnungen) versehen werden, um zarte Gemüter vor psychischen Erschütterungen zu bewahren, ist eine Folge dieser Erziehungsstrategie, die allmählich aus den USA auch nach Europa schwappt.
Wikipedia erzählt dazu:
Insbesondere an angloamerikanischen Universitäten setzen sich Studierende seit etwa den 2000ern ausgehend von den Gesellschaftswissenschaften dafür ein, dass Inhalte, die auf Menschen mit Gewalterfahrung möglicherweise retraumatisierend wirken könnten, mit Triggerwarnungen versehen werden. Dadurch soll betroffenen Menschen ermöglicht werden, in potentiell retraumatisierenden Situationen entsprechend zu reagieren, z. B. indem sie diese vermeiden und sie in einem sicheren Umfeld (beispielsweise im Rahmen einer Psychotherapie oder im Gespräch mit Vertrauenspersonen) aufzuarbeiten. Zudem hat sich ein weiteres Verständnis von Triggerwarnungen durchgesetzt, das sich auf als verletzend empfundene Inhalte bezieht. Die Auseinandersetzung um Triggerwarnungen wurde und wird insbesondere in den USA intensiv geführt. Triggerwarnungen werden dort insbesondere in Lehrveranstaltungen, die Themen über Geschlecht, Hautfarbe (englisch Race) oder Sexualität diskutieren, gefordert.
Damit soll die Spurensuche an der Basis vorerst als abgeschlossen gelten. Studenten, die vor berühmten Werken der Weltliteratur mit Triggerwarnungen geschützt werden wollen, sollten als Indiz für die zunehmende Verblödung der jungen Erwachsenen ernst genommen werden.
Dazu mehr in Teil 2 dieses Aufsatzes.